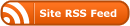Was passiert eigentlich, fragt man sich, im Iran? Dort, verkünden die Nachrichtenagenturen und die Analysten aller Dienste, passiert gar nichts. Die Bewegung ist vorbei, der Umsturz wird nicht kommen, so wie er niemals kommen wird, und nirgendwo.
Die Stille nach dem plötzlichen Aufruhr quält uns, weil sie uns so genau an die Hoffnungslosigkeit und die Monotonie erinnert, die vorher herrschte, und die für eine kurze Zeit unterbrochen schien. Es sah einen Moment so aus, als wäre das Ende einer Fase der Stagnation, des allgemeinen Stillstandes erreicht, die jetzt an die 5 Jahre herrscht, in denen buchstäblich Nichts geschehen ist ausser der langsamen Verschlechterung aller Dinge.
Man kann eine beliebige Tageszeitung von vor 5 Jahren aufschlagen und sie mit einer von vor 2 Wochen vergleichen. Man wird in der Regel keinen Anhaltspunkt finden, welche davon welche ist.
1
Aber die Bewegung ist nicht zu Ende. Sie ist unterirdisch geworden, und wühlt weiter. In ihrer ersten Fase, der der grossen öffentlichen Massendemonstrationen, hat sie mehr erreicht, als man ahnen konnte, aber ist aus Gründen, die wir in früheren Ausgaben versucht haben zu analysieren, gescheitert. Sie hat danach ausführlich Gelegenheit gehabt, ihre Taktik zu verändern, sogar ihre Gestalt.
Sie hat in dieser erstan Fase eine grosse Sturmwelle über die Oberfläche dieser Gesellschaft gejagt, und hat danach sich zersplittert, ist scheinbar von der Oberfläche verschwunden, um in den Tiefen die Fundamente des iranischen Systems zu zermürben. Der grosse Sturm ist nicht einfach vergangen, er hat sich auf die Fläche, in die Kleinstädte, die Betriebe, Schulen und Hochschulen, sogar in die Familien verteilt.
Solidarische Aktivisten, die das ganze von aussen betrachten, werden in solchen Fasen dazu tendieren, aufzugeben und sich anderer Dinge anzunehmen; so wie die Tätigkeit des Aktivisten immer nur darin bestehen kann, sich rein äusserlich auf etwas zu beziehen, sich zu solidarisieren oder auch nicht, aber immer nur mit einer Sache, die nicht die seine ist und nicht sein kann. Auch unsere iranischen Exil-Bolschewiki sind nichts anderes als solche Aktivisten; sie werden diese Sache aufgeben, wie Lenin die russische Revolution 1905 aufgegeben hatte, als sie ihn nicht unverzüglich zur Macht trug.
Diesen Gefallen wird, wie ich hoffe, die iranische Revolution unseren heutigen Bolschwiki auch niemals tun.
2
Die Bewegung hat jetzt, in ihrer Verborgenheit, bereits schon einige hervorragende Ergebnisse gebracht. Es gibt Gegenden, in denen Vollzugskräfte des Staates nicht mehr wagen dürfen, von ihren Befugnissen Gebrauch zu machen, weil sie sonst spontanen und massenhaften Widerstand provozieren; solche Vorkommnisse scheinen sich auffällig zu häufen, in der Hauptsache in Arbeitervierteln.
Es gab und gibt eine Vielzahl von Streiks, sei es um ausstehende Löhne, die das System nicht mehr in der Lage ist, zu bezahlen; und es gibt ausserdem, wie es aussieht, eine völlig neue Erscheinung, nämlich offenkundig Sabotage durch die Arbeiter, eingesetzt als bewusstes Kampfmittel.
Es gab zuletzt, endlich, einen Streik der Bazar-Händler gegen eine Steuerreform, den man wohl verstehen muss als eine Aktion des Teils der Mittelklasse, die Montazeris Richtung anhängt.
Noch aber reicht die Macht der Pasdaran, die den Staat und die Wirtschaft immer mehr beherrschen, hin, um die Massen zu kontern. In allen Fällen, in denen es zu grösseren Aktionen kommt, schlagen die Pasdaran und ihre Hilfsorgane sofort und gnadenlos zu, und das Proletariat wird es nicht leicht haben, Taktiken zu ersinnen, wie es ihnen den strategischen Vorteil der überwältigenden Feuerkraft aus der Hand nimmt.
Eine Front des Kampfes ist zur Zeit interessanterweise anscheinend völlig offen, nämlich der Kampf der Frauen. Hier hat es das System geschafft, sich auf beispiellose Weise selbst zu blockieren. Keine Fraktion der Herrschenden will es derzeit auf sich nehmen, die öffentliche Durchsetzung der sogenannten Sittsamkeit zu betreiben. Stattdessen schiebt die allgemeine Polizei es der Geistlichkeit zu, die diese Zuständigkeit empört an die nächste unzuständige Stelle weiterverweist, und so fort, bis zuletzt der Präsident zum allgemeinen Erstaunen erklärt, der Staat habe sich grundsätzlich nicht darin einzumischen, wenn zwei Leute, verheiratet oder nicht, zusammen auf der Strasse unterwegs sind. Nicht, dass der grosse Mann plötzlich seine Liberalität entdeckt hätte; sondern dem System ist eines seiner Grundprinzipien, die mehrfache Zuständigkeit verschiedener konkurrierender Unterdrückungsapparate, an einer, vielleicht entscheidenden Stelle einfach aus dem Gleis gesprungen.
Die Konkurrenz der einzelnen Apparate, in der bisher derjenige den Vorteil davontrug, der als erster zugriff, hat sich offenkundig an dieser Front in einen Nachteil verwandelt. Wenn dies so ist, und nicht etwa das dicke Ende noch nachkommt (auch dafür spricht einiges), dann hat das iranische Proletariat einen Weg gefunden, in ein System wie das iranische eine Bresche zu sprengen, und man muss ihm wünschen, das es genau studieren wird, wie ihm das gelungen ist. Zur Zeit kursieren jedenfalls Bilder von völlig unverschleierten Frauen in Tehraner Bussen.
3
Ansonsten scheint die iranische Arbeiterbewegung ein wichtiges Hindernis ausgemacht zu haben, das der Zusammenführung ihrer getrennten Kämpfe entgegensteht. Ein grosser Teil des iranischen Kapitals ist in den Händen der Pasdaran, der Repressionstruppe selbst; jeder Streik ruft sofort den bewaffneten Eigentümer auf den Plan, ob er die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt oder nicht. Eine verallgemeinerte Streikbewegung ist unter diesen Umständen ohne den sofortigen Bürgerkrieg, oder wahrscheinlicher ohne ein grosses Massaker schwer denkbar.
Wenn aber die Hinweise nicht trügen, die man vorsichtig übermittelt bekommt, dann suchen die Lohnarbeiter in der Sabotage ein vorläufiges Kampfmittel und Ausdrucksmittel, mit dem sie, wenn es gut gemacht ist, sowohl den ökonomischen Effekt eines grossen Streiks gleichsam simulieren, als auch ihresgleichen sich zu erkennen geben könnten.
So etwas funktioniert am wirkungsvollsten naturgemäss in Industrien wie der Erdölindustrie, genau dieser bis jetzt anscheinden für die Opposition uneinnehmbaren Festung, deren Aktion, so wie die des Bazars, nach der gängigen Logik der Analysten unausweichlich, wie 1978, das Ende des Regimes ankündigen muss. Und genau dort werden, zu ihrem Unglück, die Analysten die Sabotage nicht erkennen, wenn sie sie sehen. Die Sabotage, weil sie genau in der Mitte zwischen dem einfachen Versagen der ermüdeten und überanstrengten Arbeitskraft und ihrem genauen Gegenteil, dem Aufstand, steht; in der unerforschten und unergründlichen Zone zwischen der immer krisenhaften Reproduktion dieser Gesellschaft und ihrer Abschüttelung, das heisst: zwischen Schlaf und Wachen; die Arbeitersabotage können sie nicht erkennen, weil sie dazu mehr über die Grundlagen ihrer Gesellschaft wissen müssten, als man wissen kann, wenn man Analyst sein will.
Nach einem verheerenden Brand in einer Erdölanlage, die den Pasdaran gehört, erklärt z.B. ein Arbeiter schulterzuckend die Unzufriedenheit der Arbeiter zur Ursache; und schlägt eine Parallele zu anderen Katastrofen, die Einrichtungen der Pasdaran neuerdings befallen haben, unter anderem den Absturz eines Flugzeuges mit hohen Offizieren, der weithin dem Mossad zugeschrieben wird. Offiziell gilt der Brand als Naturereignis, er soll geologische Gründe haben, aber der Mann sagt: wegen der Unzufriedenheit. Er sagt nicht: wegen der Überarbeitung oder der Ermüdung. Es sind 4 Arbeiter bei diesem Brand gestorben, aber der Arbeiter sagt nichts, was auf etwas anderes als Arbeitersabotage hindeutet.
Ein seltsames Zeugnis; warum sollte er so etwas sagen? Sind es Trotz und Hilflosigkeit? Erinnert sich der Mann an Mossadegh, der dem amerikanischen Gesandten sagte: eher zünde ich das Erdöl an, als dass ich es den Briten zurückgebe? Glaubt er, dass eine Sabotageaktion grauenvoll fehlging? Man wird es nicht so schnell erfahren, bevor man, nach dieser ersten rätselhaften Meldung aus dem Erdölsektor nicht noch weitere, wahrscheinlich ebenso rätselhafte gehört hat.(1)
4
Das Exil, das neben lebensrettender Flucht auch noch etwas anderes ist: nämlich Anhäufung aller zu Recht gescheiterten Tendenzen der Opposition, hat sich noch einmal gespalten, und endlich über die israelische Frage. Vorher gab es schon zu Recht die Spaltung zwischen den Linken und den Monarchisten; jetzt haben sich die Linken gespalten, und werden sich noch weiter spalten, weil eine Reihe alter Linker nicht begreifen konnte, dass es nicht mehr 1979 ist und der antiimperialistische Traum schon lange ausgeträumt.
Diese Herren haben es für nötig gehalten, in einem längeren, auch sonst unerträglichen Manifest die palästinensische Intifada zum Vorbild des iranischen Aufstandes erklärt. Auf diese Niederträchtigkeit ist ihnen aber Antwort gegeben worden, ebenfalls aus dem Exil, und mit Worten, denen man anmerkt, dass sie entschiedener gewesen wären, wenn ihre Autoren nicht glaubten, in der Defensive zu sein; nämlich mit einer Verurteilung der palästinensischen Gewaltpolitik und der Erklärung zum Existenzrecht Israels und einer friedlichen Lösung des Konfliktes. Das klingt nach wenig, und ist doch, wenn man die Existenz derer, die es verfasst haben, in Betracht zieht, viel. Sie haben damit die Idiotie der Ganji und Genossen endgültig desavouiert, die das antiisraelische Regime antiisraelisch überschreien wollen.
Sie sprechen immer noch in allgemeinen Redensarten über die Gewaltlosigkeit des Widerstands, als ob der iranischen Revolution die Gewalt erspart bleiben könnte; und als ob die palästinensische Gewaltkampagne plötzlich gerechtfertigt wäre, wenn die iranischen Arbeiter sich eines Tages genötigt sähen, sich zu bewaffnen. Die Autoren des zweiten Briefes sprechen zuletzt, wie die des ersten, nur für sich selbst.
Damit ist aber zugleich zum ersten Male öffentlich den Herren Akbar Ganji und Genossen, der Generation, die die Pasdaran aufgebaut haben, das Recht bestritten worden, für die iranische Opposition zu sprechen. Diese neuerliche Spaltung kann man als Freund des iranischen Aufstandes nur begrüssen, ausser dass man sich deutlichere Worte wünscht, zu denen aber bei den neuen Linken vielleicht der Wille, aber nicht der Mut da ist. Diejenigen, deren Bestrebungen die neuen Linken zu vertreten beanspruchen, werden, wie wir hoffen, diesen Mut haben; sie werden ihn auch brauchen.
5
Insgesamt erscheint die iranische Bewegung als erstaunlich unbeschädigt, unfassbar trotzig und auf eine hintergründige Weise kreativ; jedenfalls aber lebendig und voller Zorn. Ich spare mir Bemerkungen über das Treiben der Eliten, ausser der, dass die Fraktionen nicht nur unverändert im Stellungskrieg miteinander liegen, sondern, kaum dass der unmittelbare Choque der Massenmilitanz nachgelassen hat, sogar noch in umso mehr Fraktionen zerfallen ist. Die Gerichtsbarkeit und die Polizei, Geistlichkeit und Pasdaran, Präsident und Parlament, eine Vielzahl eigener Körperschaften sind einander bereits an den Kehlen; das ist normal für einen Staat wie die Islamische Republik, aber die Vehemenz ist neu; sie ist die von Ertrinkenden, die um ein Rettungsboot kämpfen.
Was vor einem Jahr im Iran seinen Kopf gehoben hat, wird das noch einmal tun. Es wird noch etwas dauern, zu lange, aber es hat alles schon zu lange gedauert. Die Trägheit, zu der wir durch die Ereignislosigkeit und Aussichtslosigkeit verurteilt sind, und in der unsere besten Fähigkeiten verkümmern, kann man jedenfalls den Iranern nicht zum Vorwurf machen. Sondern allein uns, die wir unfähig geworden sind, ohne ein leuchtendes Beispiel zu revoltieren. Und hier ist noch nicht einmal die Rede von denjenigen Linken, die so einverstanden sind mit allem, dass sie die Revolution, wo sie ausnahmsweise wirklich ansteht, nur für eine Manipulation des Mossad zu halten vermögen; so als ob, wie bekanntlich die Antideutschen meinen, wirklich nichts gutes auf der Welt mehr wäre, hinter dem nicht der Mossad steckt.
1 Die andere Frage ist, ob man sie verstehen wird, ohne Antideutscher und Operaist gleichzeitig zu sein, was aber unmöglich ist.