Gedanken über das Duzen und das Siezen
Die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft eingerichtet ist, die omnipräsente Herrschaft, bestimmt die Formen unseres Handelns, formt unser Selbst und überwölbt ebenfalls die Formen zwischenmenschlicher Kommunikation. Sowohl das Duzen, als Gemeinschaftsgefühl stiftende Form der Anrede, scheinbar ohne Statusunterschiede zwischen den sich duzenden Personen, als auch das Siezen, als Höflichkeitsform, die sich gar nicht die Mühe macht, die Rangunterschiede zwischen Menschen zu überdecken, sind ohne das Prinzip der Herrschaft nicht zu denken und würden in dem Moment, in dem eine Gesellschaft für den Menschen mit all seinen Möglichkeiten geschaffen würde, nichtig werden.
Schon in frühester Kindheit wird die Fratze der Fremdbestimmung artikuliert: Vor gar nicht allzu langer Zeit sprachen die Kinder ihre Eltern, vor allem ihren Vater als autoritären Patriarchen, noch mit „Sie“ an. Damit verbunden war die Vorstellung einer strengen Erziehung, die dem kindlichen Individuum keinen Platz einräumte und den Rangunterschied klar vor Augen führte. Heute duzt man sich in der Familie, stiftet damit Gemeinschaftsgefühl und kuschelige Wärme in einer eisigen Verwertungsgesellschaft. Aber auch das Duzen innerhalb der Familie ist an die Herrschaft gebunden: Eine Gesellschaft, die so etwas wie die Familie nötig hat, um den Wahnsinn der Verwertungslogik ertragen zu können, ist noch immer die Verneinung des Menschen. Mit dem „Du“ in der Familie werden zugleich Besitzansprüche geltend gemacht, die dem Individuum äußerlich sind: „Du bist eineR von uns“. Die gemeinsame Abstammung, der Lebensweg, den sich die Eltern für ihre Kinder imaginieren, er wird zur Kette für die Emanzipation des Individuums. Die Aussprache dieser Geißel ist das Duzen, das im familiären Bereich, ebenso wie im Arbeitsleben, Gemeinschaftsgefühl stiftet und doch die Knechtschaft beinhaltet.
Das Herrschaftsverhältnis zwischen „Erwachsenen“ und „Kindern“ bzw. „Jugendlichen“ kommt auch in Ausbildung und Beruf zur Sprache: Der Lehrer, der die Schülerin duzt, die Meisterin, die den Stift wie ein verschüchtertes Kind behandelt und mit „Du“ anredet: Die materielle Überlegenheit drängt zum Gedanken, drängt zur Artikulation. Das Individuum wird infantilisiert, bis weit ins Erwachsenenalter hinein. Wer genug Kulturkapital anhäuft, darf sich letztendlich selbst Siezen lassen, darf die Herrschaft dann selbst ausüben und hat damit auch den Status erworben, den anderen die gleiche Gewalt anzutun, die einem/einer in der Schul- oder Ausbildungszeit selbst widerfuhr.
Eine liberale Gesellschaft, die das Pursuit Of Happiness für jedeN EinzelneN proklamiert, muss auch zwangsläufig die Statusunterschiede in der Kommunikation verwischen. Im Anglo-Amerikanischen Raum ist es längt gang und gäbe, dass man sich im Betrieb mit dem Vornamen anspricht. Dieses Konzept der „Formlosigkeit“ greift mittlerweile auch nach Deutschland über. Durch diese persönliche Anrede wird ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt, als ob alle zusammen an einem Strang zögen. Die Lüge, dass es keine Statusunterschiede gebe, die Falschheit, dass alle zusammen arbeiteten und nicht jedeR für sich, wird durch das familiäre „Du“ verewigt, bis die Menschen selbst davon überzeugt sind, dass es die Individuen sind, die gemeinsam den Markt gestalten, und nicht das automatische Subjekt der kapitalistischen Wertgesellschaft. Die Formulierung von Herrschaftsverhältnissen und die moderne Version der Verschleierung treibt im deutschsprachigen Raum die absurdesten Blüten: Mit dem so genannten „Hamburger Sie“ Siezt man sich und verwendet trotzdem den Vornamen, in anderen Betriebe duzt man sich und spricht sich trotzdem mit dem Nachnamen an. Es stellt sich also in Betrieben die Frage, ob man sich im Arbeitsleben nach wie vor Siezt und somit die reale Entfremdung zum Ausdruck bringt, oder diese durch das Duzen mit einer Lüge überdeckt.
Am dreistesten ist die Attitüde der hippiesquen One Family, die durch das Duzen jeden Menschen zu ihrem/ihrer FreundIn machen möchte. Der Vergemeinschaftung der Menschheit durch die Sprache liegt daher eine Geisteshaltung zugrunde, die keine Widersprüche zulässt, sondern jede Form des Unterschieds zwischen den Individuen übertünchen möchte. Auch in linken und subkulturellen Kreisen spricht man sich von Vorneherein mit „Du“ an. Auch dadurch wird ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen, mit dem das Eigene und das Fremde formuliert und definiert wird. Auch dieses gruppeninterne Duzen ist einer Gesellschaft geschuldet, die sich eine familiäre Umgebung nach innen schaffen muss, um die Zumutungen des Kapitalismus zu ertragen.
Man kann dem Siezen durchaus unterstellen, die ehrlichere Form der Anrede zu sein- nicht jedoch die bessere, die unter den Bedingungen der Herrschaft nicht zu bestimmen ist. In einer Gesellschaft, die als Klassengesellschaft konzipiert ist und auch nur so funktionieren kann, hat das Siezen als Zeichen des Statusunterschiedes seine Berechtigung. Noch mehr als das: Das Siezen drückt direkt aus, in welch entfremdeter Form sich zwischenmenschliche Beziehungen unter kapitalistischen Bedingungen abspielen. Wir können Fremden nicht per-Du sein, solange jedeR um das materielles Interesse für sich und allein für sich kämpft.
Das Duzen und das Siezen, beide sind Kehrseiten der wertgesellschaftlichen Medaille: Ob die Sprache nun ausdrückt, dass es Herrschaftsverhältnisse gibt, oder sie sich einbildet, wir alle seien eine Familie: der Kapitalismus benötigt keine Sprache, sondern ist rohe Gewalt. Was zwischenmenschliche Beziehung, was Freundschaft, was Menschlichkeit sein könnte, dies alles können wir unter den Bedingungen der Herrschaft der Wertverwertung nicht einmal erahnen. Und welche Formen der Kommunikation ohne die Formulierung von Statusunterschieden oder ohne die Lüge ihrer Nicht-Existenz möglich sein werden, ebenso. Sowohl das Siezen, als offen entfremdete Form der Anrede, als auch das Duzen, als versöhnende Lüge, würden in einer klassenlosen Gesellschaft ihre Bedeutung verlieren.
von Yvonne Hegel
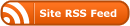
selber schuld, wer uns liest.
der kapitalismus ist rohe gewalt, erst die revolution wird die gewalt, als gekochte gewalt, in die regionen verfeinerter esskultur aufheben.
lang lebe der letzte hype, das fachblatt für platituden und verfeinerte esskultur!
finko b., herausgeber
p.s. die redaktion des letzten hype bittet für diesen kommentar um entschuldigung. wir haben leider noch kein mittel gefunden, unsere herausgebr davon abzuhalten, betrunken kommentare zu posten. wir distanzieren uns, wie man so schön sagt, aufs schärfste.
die redaktion
„…der Kapitalismus benötigt keine Sprache, sondern ist rohe Gewalt.“ Aua, diese Plattitüde tut schon weh!
„gemäss robert kurz treiben die waren ja bereits kommunismus.“
wo hat er das denn geäussert?
warengesellschaft: nur, wenn es die ware wirklich will.
gemäss robert kurz treiben die waren ja bereits kommunismus. gut so! ich habe mich immer gefragt, was meine waschmaschine und mein bügeleisen eigentlich machen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen.
was hast/haben du/sie denn gegen die warengesellschaft/in/ten?
quatschiquatschi du frau hegel!