Die „Negative Dialektik“ als Handbuch der Revolution
1
Ndejras Text über die kritische Theorie aus hype #12 bestätigt alle meine Befürchtungen, aus der universitären Vereinnahmung der kritischen Theorie könne nur das schlimmste kommen, auf das schönste; und das teils gewollt, teils ungewollt.
Kritische Theorie kann heute nicht mehr an Universitäten gelehrt werden. Was unter diesem Namen heute allenfalls verkauft wird, ist Surimi. Wenn es einmal eine Zeit gegeben hat, in der Adorno und Horkheimer an Universitäten lehren konnten, dann wird man diese Zeitalter nach den Gründen befragen müssen, aber nicht unseres.
Kritische Theorie kann heute nicht mehr anders betrieben werden als an verrufenen Orten und von wenig empfehlenswerten Leuten. Sie ist, nachdem die deutschen Studierenden von 1968 epochal an ihr gescheitert sind, nur noch an die Universität zu bringen um den Preis, sie um das zu verkürzen, was ihr Innerstes ist: das verzweifelte Wissen von der Unwahrheit des Ganzen, und das Feuer, das in dieser Verzweiflung und nur in dieser Verzweiflung noch brennt.
Dass diese Verkürzung möglich ist, haben der Dozent Zimmermann und seine Schule eindrucksvoll bewiesen. Über diese Schule ist zur Zeit ihres Bestehens leider nicht mehr das notwendige gesagt worden, und jetzt, wo sie nicht mehr besteht, ist es nicht mehr notwendig. Der Staat hat es nicht mehr für erforderlich gehalten, diese Veranstaltung weiterzubetreiben. Sie war ohnehin anachronistisch: es gibt heute kein unruhiges Denken unter Studierenden mehr, und zu dessen Zähmung und Unterwerfung sind solche Einrichtungen allein gut, und zu sonst nichts.
Die zu solchen Zwecken entstellte Lehre will uns Ndejra aber gar nicht als diejenige kritische Theorie vorhalten, die den Gegenstand seiner Kritik abgeben soll; sie ist also auch nicht Gegenstand der Erwiderung.(1)
2
Sondern was? Man weiss es auch nicht so recht. Man weiss auch nicht so recht, wo anfangen. Ndejras Text hat einen Grundgedanken, den er unter Geröll dekoriert, das grob aus drei Teilen besteht: ein Teil einigermassen bekannter und gängiger Clichees, ein Teil Ausrisse aus Sekundärliteratur, deren Autoren sich nicht die Mühe gemacht haben, ihren Gegenstand zu durchdringen, und ein weiterer Teil, der sich darauf zurückführen lässt, dass Ndejra selbst sich nicht die Mühe macht, seinen Gegenstand zu durchdringen.
Der letzte Teil ist der unkomplizierteste: man kann es niemandem zum Vorwurf machen, die Schriften einer Schule, an der ihm nichts liegt, nicht lesen zu wollen. Niemand soll dazu gezwungen sein. Allerdings ist auch niemand gezwungen, dann über diese Schule zu schreiben. Ndejra könnte z.B. viele seiner Gedanken in Horkheimers Schriften aus dem Band über „Traditionelle und kritische Theorie“ wiederfinden, nur wesentlich ausführlicher formuliert, oder sich zumindest damit auseinandersetzen.(2) Er kann es auch bleiben lassen, aber das ist sein Privatgeschäft.
Die sekundären Autoren, die er zitiert, interessieren wiederum mich nicht, und ich gebe zu, das ist mein Privatgeschäft, aber er hat sie auch nicht als allzu verlockend dargestellt. Wenn ein gewisser May das „taktische politische Denken“ des Anarchismus „noch mit Poststrukturalismus bestärken und radikalisieren“ will, wie Ndejra selbst vorträgt, dann qualifiziert sich May dafür, von der Universitätsbibliothek für interessierte Studierende gekauft, und von Leuten wie mir ignoriert zu werden. Und der Rest klingt noch langweiliger. Ich werde es nicht lesen, dazu ist mein Leben zu kurz.
Wirklich unangenehm sind aber zunächst die Clichees über die kritische Theorie, die er wiederverwendet, als könne er das einfach. Dass gewisse deutsche Studentenführer von 1968, in dem Moment, als sie aufgehört haben, zu rebellieren, und anfangen wollten, die Massen zu führen, feststellen mussten, dass die kritische Theorie für diesen Verrat an der Revolte nicht zu haben war, das ist eine Sache. Dass sie ihre Vorwürfe gegen Adorno in die Sprache der maoistischen „Kulturrevolution“ kleideten, war nur konsequent. Dass aber Ndejra darauf hereinfällt, ist mir einfach zuviel.
Mir gefällt schon einmal die „Underdog-Perspektive“ nicht, die er einnehmen will. Er studiert, das hat er selbst geschrieben; und er schreibt wie ein Student; in wessen Namen will er sprechen? Im Namen der „underdogs“? Bitte nicht. Er spreche, etwas anderes steht heute niemandem zu, in seinem eigenen Namen, das ist gut genug, einen anderen hat er nicht, und etwas anderes wird ihm auch nicht geglaubt werden.
Und die Pose, dass Adorniten grundsätzlich rich kids sind, und er ein underdog, soll ihm jemand anders abnehmen als ich. Ich werde nicht kommentieren, aus welcher Schicht ich stamme, und meine Sätze werden nicht desto wahrer, je ärmer und illiterater meine Eltern waren, und gerade so geht es den seinen.
3
Adornos Sprache ist „hochgestochen“! Ich kann es nicht mehr hören. Die Dichter der Revolte, Rimbaud, Lautreamont, Baudelaire, haben sich auch nicht in der Sprache der Arbeitervorstädte ausgedrückt. Es tut mir nicht leid, aber es ist das Proletariat, das lernen wird müssen, sich der Sprache zu bedienen.
Im Übrigen kann man auch die Proklamationen der Commune de Paris für „hochgestochen“ halten, und die sind wohl, soweit man sie heute noch kennt, von Arbeitern verfasst worden.
Die Situationisten haben wenigstens noch gewusst, dass die Arbeiter Dialektiker werden müssen, wenn die Revolution kommen soll. Das unterscheidet sie von den Linken, die immer versucht haben, die Sprache der Arbeiter zu lernen, als ob sie nicht wüssten, dass es so etwas nicht gibt. Wer ernsthaft jemals das Verlangen nach ungehinderter Entfaltung der Menschheit, das heisst nach Emanzipation des Proletariats, formulieren will, muss das auf der Ebene tun, die dafür alleine taugt: die höchsten Höhen der Sprache, der Musik, der Kunst, jeder Form des Ausdrucks. Wer auch immer, um der angeblichen Verständlichkeit für die sogenannten Massen halber, darauf verzichtet, sagt ja zum Ausschluss des Proletariats von den Mitteln des Ausdrucks.
Dass heute schon Studenten der Geisteswissenschaften die Sprache Adornos nicht verstehen, könnte man sehr gut als Argument gegen das studentische Milieu wie als Argument gegen die Universität gebrauchen; aber Ndejra zieht es stattdessen vor, ein allzu billiges Argument gegen Adorno draus zu machen, um eines illusorischen Disktionsgewinns gegen die ebenso illusorische Zimmermann-Schule willen.
4
Pessimistische Kulturkritik! Grossbürgerliche Resignation! Ndejra bemüht wirklich alle Frasen, die es jemals gegen die kritische Theorie gegeben hat, und es wird ihm gar nicht langweilig. Noch weniger werden ihm diese Frasen etwa verdächtig, obwohl sie doch nicht zufällig sämtlich von Georg Lukacz stammen; aber Ndejra versäumt auch hier die günstige Gelegenheit, zu untersuchen, wieso solcher leninistischer Unsinn sich auch in einem anarchistischen Kontext ganz gut macht. Es wäre interessant gewesen; vielleicht ist es ja auch ein Anzeichen eines ganz unvermutet ähnlichen, bisher ungebrochenen Verständnisses von Politik?
Unabhängig davon, ob man Adorno das Epitheton „grossbürgerlich“ umhängen kann, stellt sich doch die Frage, ob der Teil des Proletariats (und zu dem beanpruche ich zum Beispiel zu gehören), der die Negative Dialektik für ein eminent revolutionäres Buch hält (3), nun selbst „grossbürgerlich“ geworden ist, oder nur nach Art der Grossbürger resigniert hat; wie es Grossbürger, wer auch immer das sein soll, ja bekanntlich tun; man kann solche Frasen nicht versuchen zu verstehen, ohne dass sie sich im Unsinn auflösen.
Die Wurzel und gleichzeitig Krone des ganzen ist der Vorwurf, die kritische Theorie sei praxisfeindlich, und auch diesen Vorwurf spart sich Ndejra nicht; er vermisst das für die Praxis „passende begriffliche Instrumentarium“ und die Ermutigung. Wie aber, wenn es der Ermutigung gar nicht bedürfte, wenn sie das reine Gift wäre, und es für den Aufstand stattdessen unverzichtbar wäre, sich schaudernd der Lage bewusst zu werden? Und wenn das „passendes begriffliches Instrumentarium“ auf nichts herausliefe, als der politischen Praxis auch noch das freie Refugium des wenigstens kritischen Gedankens zu unterwerfen?
Theorie kann nicht etwas sein, dessen man sich zu dem scheinbar vorgegebenen Zweck (Veränderung der Welt) bedienen kann; so dass die Konkurrenz zwischen verschiedenen zunächst gleichwertigen Theorie-Modellen dadurch entschieden würde, welche dem Zweck am besten dient. Theorie, überhaupt als Handlungsanleitung verstanden, ist nichts anderes als ein Rudiment dessen, was für Georg Lukacz z.B. noch die Partei gewesen ist, Theorie ist dasjenige, nachdem sich, unter der Aufsicht der dafür berufenen Intellektuellen, die Wirklichkeit zu richten haben wird. Eine so verstandene Theorie ist eine Zumutung, derer sich gerade Kritiker der Herrschaft wie Ndejra zu erwehren wissen sollten, auch handgreiflich.
Theorie, die nicht zur Anleitung für Herrschaft verkommen will, hat unpraktisch, sogar antipraktisch zu sein. Sie hat als ihren nächsten Feind die von „Theorie“ angeleitete Praxis zu erkennen und zu bekämpfen. Diese Praxis, und diejenige Theorie, die Praxis leiten will, sind völlig unvereinbar mit Reflexion.
Und Reflexion tut not, sie ist so nötig wie die Luft zum Atmen, sie brächte zum Beispiel zu Bewusstsein, dass so etwas wie kritische Theorie dann sein muss, wenn die Möglichkeit der praktischen Kritik verstellt ist. Die kritische Theorie wäre allenfalls zu kritisieren, wie man früher einmal die Kunst kritisiert hat: als Refugium des abwesenden Besseren, aber immerhin als ein geduldetes, umstelltes, marginalisiertes Refugium. Aber als Refugium.
5
Der Weg zur praktischen Kritik aber ist wirklich verstellt, und mit dieser Erkenntnis muss jedes revolutionäre Denken anfangen. Es ist niemandem damit geholfen, dieser Erkenntnis auszuweichen oder sie am besten der kritischen Theorie aufs Schuldkonto zu schreiben.
Die kritische Theorie Adornos reflektiert das Scheitern der Revolution, die einmal versucht worden ist und gelingen hätte können; eine Niederlage, die wir als unsere Niederlage erkennen müssen. Jeder Versuch, sich dieser historischen Haftung zu entziehen, mündet in Selbsttäuschung. Genau diese Selbsttäuschung ist das Betriebsklima der Linken. Sie hält sich am leben durch ihre jämmerliche Illusionen darüber, wie aussichtslos die Sache der Befreiung durch ihr damaliges Scheitern geworden ist, und wie gründlich dieses Scheitern gewesen ist.
Wenn Ndejra den Antideutschen, zu denen wohl ich mich auch zu rechnen habe, vorwirft, die Shoah zum Zentrum einer negativen Geschichtsmetafysik zu machen, dann lässt mich das ratlos zurück. Ist ein kritisches Denken ohne Selbstbetrug möglich, dass nicht von der historischen Niederlage ausgeht? Und hat diese Niederlage eine schrecklichere Gestalt angenommen als die, dass nur wenige Jahre später die meisten europäischen Jüdinnen und Juden ermordet werden, ohne dass sich eine Hand dagegen wehrt; was soll das heissen, diese Sache „angemessen“ zu untersuchen, wie Ndejra fordert? Wie kann man so etwas angemessen untersuchen, wo noch nicht einmal z.B. die Bomben auf Würzburg auch nur entfernt angemessen waren?
6
Das war das Geröll. Was aber ist der Grundgedanke? Ich finde keinen, ausser dass Ndejra Adorno nicht mag, weil er fürchtet, dass ist etwas für Idioten, die gerne gescheit daherreden, obwohl sie nichts verstanden haben. Wenn dem so ist, sei er beruhigt: gegen solche Idioten kann keine Denkschule sich erwehren, es sei denn mit Gewalt, vor allem nicht da, wo sie nur toter Gegenstand der Betrachtung und Vereinnahmung ist, also an der Universität. Denn dort, aber auch nur dort, wird den Idioten unweigerlich alles geglaubt. Ausserhalb dieses ungesunden Milieus kann „jeder sich Dadaist nennen; dafür, dass er es ist, muss er selbst sorgen“ (Raoul Hausmann).
Oder täusche ich mich, und auch er stört sich daran, dass mit der kritischen Theorie kein politisches Geschäft getrieben, keine silberne Zukunft versprochen, keine Organisation geführt werden kann; dass sie das Denken nicht an die Verwalter der Praxis verraten wird, und dass sie, nach der historischen Katastrofe, einen Bruch einfordert, der es unmöglich macht, einfach und blind und ohne das Bewusstsein dieser Katastrofe weiterzumachen? Dann, aber das wird nicht der Fall sein, könnte ich ihm auch nicht helfen.
Von Jörg Finkenberger
1 Reden wir nicht mehr von der Zimmermann-Schule! Ich gehe davon aus, dass man sich darauf einigen kann: das war tatsächlich ein Haufen Leute, die ihre eigene Nichtigkeit hinter Frasen versteckt haben, die ihnen selbst so unverständlich geblieben sein mussten wie denen, die sie damit beeindrucken wollten. Für den Gestus des Priester-Intellektuellen eignen sich doch andere Schulen, die Foucaults etwa, viel besser, weil es für die Hochstapler dort nichts gibt, was sie etwa verstanden haben müssten. Ndejra hat seine Kritik aber nicht auf diese Leute, sondern auf die kritische Theorie bezogen, ist also diesen Idioten auf den Leim gegangen. – Übrigens wäre diese Schule besser dadurch zu charakterisieren, dass ihr Guru, als eine Art linkerer Habermas, die ganze Tendenz Adorno mit aller Gewalt im „demokratischen Sozialismus“, also im Wunschtraum der Sozialdemokratie, hat aufgehen lassen wollen. – Wenn übrigens, wie es mir scheint, Zimmermann eine Hauptquelle für Ndejras Kenntnisse der kritischen Theorie sein sollte, dann ziehe ich meine ganze Kritik insofern zurück, als ich nicht ausgerechnet der sein will, der den einzigen Menschen, der es heute tut, daran zu hindern sucht, das zu tun, was unser Mustafa Khayati schon 1967 gefordert hat: dass die Studierenden anfangen müssen, gegen ihre Studien zu rebellieren.
(2) Irgendwie kann ich auch in dem, was er über die Auffassung der Naturbeherrschung oder die sogenannte Anthropologie in der kritischen Theorie sagt, die kritische Theorie nicht recht wiedererkennen.
(3) Ziemlich das revolutionärste des Jahrhunderts, und ich rede nicht von einer bloss gedachten oder bloss filosofischen Revolution, sondern von einer sehr materiellen, die es wirklich gegeben hat, die fehlgeschlagen ist, und deren Wiederaufnahme sich auf kein anderes Denken stützen kann, schon gar nicht dasjenige etwa Debords; den die schaurige Lücke, die mitten in seinem Denken klafft, gar nicht zu irritieren schien, der filosofierte, als ob es die Shoah nicht gegeben hätte – verliert er denn auch nur soviel wie ein Wort darüber? – Wie verdächtig ist so ein Denker eigentlich? Und so ein Denken? Ist es nicht fast schon ein Grund, sein Buch fortzuwerfen? Aber ich werde es nicht tun, dazu parafrasiert er mir Adorno doch viel zu hübsch.
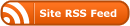
Gut!