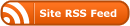Die Realität, die uns umgibt, ist in den wesentlichen Grundzügen um 1977 entstanden, wenn man unter Realität den konkreten Verlauf der Linien zwischen der konterrevolutionären Ordnung einerseits und den rapide kleiner werdenden Freiräumen dessen meint, was einmal eine Revolte war. Der Begriff konterrevolutionär hat in diesem Sinne eine sehr präzise Bedeutung, und die heutige Ordnung ist nichts anderes als die Antwort der Herrschaft auf eine konkrete Bedrohung, ein zur gesellschaftlichen Form gewordene permanenter Gegenangriff. Dass diese Ordnung noch erkennbar ist als der tägliche Terror, aus dem sie im Grunde besteht, ist die Voraussetzung dafür, dass sie abgeschafft werden kann.
1. 1968 war keine Angelegenheit der westberliner Studenten, und nur aus der zweifach bornierten Perspektive, der provinzielldeutschen und der sozialen der neuen Mittelklasse, kann es erscheinen, als sei es damals um die Notstandsgesetze oder um die Universitätsreform gegangen. Leider hat genau diese neue Mittelklasse der früheren Studenten die Geschichte geschrieben; sie bildet sich nämlich auch ein, sie gemacht zu haben. Im italienischen gibt es den Begriff vom „68 der Arbeiter“, und ein kurzer Blick auf die internationalen Gleichzeitigkeiten zeigt den französischen Mai 1968 als einen blossen Kulminationspunkt einer Angelegenheit, die von Argentinien bis Zaire im wesentlichen gleiche Züge trug, weil sie gegen ein Leben gerichtet war, das im wesentlichen überall gleich geführt wurde.
Unterschiedlich war allerdings von Land zu Land die spezifischen Formen der Niederlage, die spezifischen Verlaufsformen des Gegenangriffs. Die Staatsstreiche und die Massaker, die Deindustialisierung und die Verelendung, die Postmoderne und die New Economy haben der heutigen Gesellschaft ihre Züge aufgedrückt: sie scheinen ewig, aber sie sind nicht viel älter als ich. Ewig scheinen sie, weil mit der Revolte immer auch die Erinnerung daran ausgelöscht worden ist. Diese Gesellschaft hat kein Gedächtnis, sie lebt immer auf der Höhe der Katastrofe, und jede Panik ist in ihr ständig abrufbereit. Was namentlich vor 1977 war, ist schon völlig unvorstellbar geworden, hinter einer verspiegelten Wand verschwunden.
2. In dieser Welt hat der Irrtum eine gewisse Plausibilität, als habe Punk die Negation erfunden. Er hat sie nur geerbt, nachdem die wirkliche Revolte aus der Welt getrieben war. Punk ist in einem die nur illusorische Revolte, und im selben Platzhalter der wirklichen Revolte. Daraus erklärt sich seine zweideutige Stellung. Punk findet sich einer Welt gegenüber, die über alle Einwände schon hinweggegangen ist; Widerstand ist bereits zwecklos, mit den Zuständen ist nicht mehr zu rechten. Die Trennung des Menschen von seinem gesellschaftlichen Wesen ist eine Tatsache, über die kein ernsthafter Streit mehr möglich ist. Die vollendete Isolation ist ein fait accompli. Ein gemeinsames mit der Gesellschaft gibt es nicht mehr. An Punk erscheint noch einmal die wütende Negation der vorangegangenen Revolte, nur abstrakter und eben deshalb selbst zerstörerischer; im Stande ihrer völligen Aussichtslosigkeit. Gegenüber dem Punk erscheinen alle Klassen tatsächlich als eine einzige reaktionäre Masse; mit Wut fällt er ein Gesellschaft an, mit der sich bereits alle abgefunden haben, und genau deshalb verfällt er ihr zuletzt. Vom Punk nimmt die Neuerrichtung der Musikindustrie ihren Anfang, die bis heute in den verschiedenen Spielarten ihrer gleichermassen reduzierten Musikrichtungen eine zur verlängerten Infantilität verdammte Jugend in ihrem Bann hält.
3. Um 1968 hatte noch ein junges Proletariat tatsächlich mit einer genauso wütenden, nur massenhafteren Konsequenz die Grundlagen dieser Gesellschaftsordnung angegriffen, und zwar von innen her, aus den Fabriken, und nicht weil sie wollte, sondern weil sie musste. Die Fabrik, das war damals das Schicksal der überwiegenden Mehrzahl; erst später besass das Kapital die Vorsicht, die meisten und vor allem die unruhigsten gar nicht erst in die Fabriken zulassen, sondern ihnen woanders eine genauso stumpfsinnige Rolle zuzuweisen, wo sie nicht soviel Schaden anrichten konnten.
Die Revolte war so unberechenbar, wie sie den heutigen bemühten Historikern unerklärlich ist; sie wird deshalb am besten peinlich verschwiegen. Wie soll man auch erklären, dass damals Streiks geführt worden sind für keine oder nur für lächerlich unerfüllbare Forderungen, erbittert und lange, mit Strassenschlachten und Fabrikbesetzungen, offenbar aus keinem anderen Grund, als weil man die Arbeit genau sosehr hasste wie ihre erbärmliche nutzlosen Produkte, die man für ihren Lohn kaufen sollte? Dass Streiks ausgebrochen sind, unmittelbar nachdem die wohlüberlegten Forderungen einer Gewerkschaft vom Management bedingungslos angenommen worden waren: weil es viel zu klar war, dass kein Geld jemals ersetzen konnte, was die Arbeit einem wirklich nahm? Und dass jede Forderung sinnlos war, die nicht auf unerfüllbares zielte?
Es war keine einfache Niederlage; denjenigen, hinter denen sich die Fabriktore nach einem solchen Fest wieder schlossen, waren in der Tat nicht mehr zu helfen. In Italien, wo die Sache unter der Parole der Autonomie länger und heftiger gefochten wurde als anderswo, schieden sich die Elemente in der Bewegung von 1977. Sie ist der Beginn von allem, was wir kennen.
4. 1977 begann die Flucht aus den Fabriken. Es war kein Bleiben mehr in der Hölle, komme, was wolle. Das Kapital seinerseits bemühte sich nach Kräften, die gefürchtete rebellische Ware Arbeitskraft durch Automaten zu ersetzen: so entstanden die Grundlagen der New Economy wie der Massenarbeitslosigkeit. Die Revolte in den Fabriken war von der Gesellschaft getrennt gewesen, das war ihre Schwäche; in den besetzten Fabriken ist einmal tatsächlich anders gelebt worden, aber ausserhalb ging alles weiter seinen Gang. Die aus den Fabriken auszogen, wollten die Revolte in das alltägliche Leben tragen; und es war auch höchste Zeit dafür. Aber als sie gingen, verschwand die Revolte aus der Fabrik. Die 1977er Bewegung schuf ein Netzwerk kleiner Verlage und Zeitschriften; sie misstraute der Kommunikation der so genannten Öffentlichkeit und zog daraus den Schluss, Gegenkultur und Gegenöffentlichkeit müssten selbst organisiert werden. Sie wandte sich von der Politik ab, weil Politik auf einer Logik der Repräsentation beruht, die selbst nur wieder Herrschaft erzeugt. Die 1977er Bewegung war die erste offiziell antipolitische Massenbewegung der Geschichte. Sie betrieb ihre Sache zum ersten Mal nur im eigenen Namen und auf ihren eigenen Titel hin. Die Negation dieser Gesellschaft erscheint nicht mehr an einer bestimmten Klasse der Gesellschaft. Sie erscheint an einem bestimmten Sektor der Gesellschaft, und die Logik der Repräsentation hat auch die Gegenkultur eingeholt: sie ist nur die Darstellung einer Bewegung der Aufhebung, klar und deutlich getrennt und in sicherer Entfernung von den tragenden Pfeilern. Es ist seither wenig anders geworden.
5. Punk, in der 1977er Konstellation entstanden und mit allen ihren Widersprüchen geschlagen, hat nicht fertig bringen können, was nicht zu machen ist: dem Verdrängten eine Stimme zugeben, eine universale Sprache der Negation. Die Zersplitterung, die vordringlichste Leistung der Konterrevoltion, setzt sich in Punk und durch Punk fort: die Trennung der Revolte von der Gesellschaft und ihre Abspaltung in eine Subkultur setzt sich fort in die Trennungen voneinander fremd gegenüber stehenden Subkulturen, die zu Identitäten erstarren. Die Logik der Abspaltung erzeugt verarmte Stile von verräterischer Eindeutigkeit, klar abgegrenzte Subkulturen, denen schon anzusehen ist, dass sie Marktsegmente sein werden und sonst nichts: ideales Futter für eine Musikindustrie, die ihrer Kundschaft ohnehin nichts anderes verkaufen kann als leere Identität. Punk hat vielleicht nur für einen Moment gelebt, vielleicht auch gar nicht. In der geglätterten Geschichte der glitzernden Ödnis namens Kunst erscheint er als unerklärliche Episode, als Einbruch von etwas völlig Anderem in diese schöne Welt; wie entlarvend, immer noch! Er verweist auf etwas, das nicht gewesen sein soll. Die Revolte ist aus den Geschichtsbüchern gestrichen: sie ist schon nicht einmal gewesen.
Aber ihre Trümmer stehen noch, wir wohnen darin; und schon die Erinnerung kann in dieser Welt ohne Gedächtnis eine Bedrohung sein. Denn das versteinerte weiss, dass es wieder flüssig werden kann. Nur noch in diesem Sinne kann Punk wieder eine Bedrohung werden.
von Jörg Finkenberger