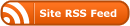Über die kommenden Revolten, Teil 3
Illuminate my Nights
Die Racaille und der Kärcher (1)
Über die kurze und heftige Revolte von Ende 2005 in den französischen Vorstädten ist bereits genug geschrieben worden; sogar kluges. Ich meine nicht die offizielle Presse, auch nicht die Pädagogen und andere Polizisten, die die Revoltierenden entweder der fürsorgenden Aufmerksamkeit des sozialen Staates, oder des religiösen Establishments empfahlen; nicht die lächerliche Linke, die ihnen allen Ernstes riet, sich als Wähler zu registrieren, um die Sozialistische Partei zu wählen; es ist wichtig, zu begreifen, dass die Revolte sich zu allererst gegen alle diese richten musste, und gerichtet hat, und jedes Wort aus dieser Richtung ist zuletzt nichts anderes als ein Appell an den Kärcher.
Pädagogen und andere Polizisten
Die Parteien der Ordnung haben sich alle Mühe gegeben, der Bewegung alle nur denkbaren Ursachen unterzuschieben, um sich selbst zur Behebung dieser Ursachen zu empfehlen; die Revoltierenden indessen haben geschiegen, sieht man von den überdeutlich-unlesbaren Chiffren ihrer Taten ab (2). Sie haben keine Forderungen aufgestellt, als ob sie wüssten, nichts von dieser Ordnung zu erwarten zu haben; sie haben keinem derer, die so gerne ihre Fürsprecher geworden wären, das Wort erteilt. Man weiss nicht recht, war es eine gewisse staunenswerte Klugheit der Revolte, die sie gelehrt hat, dass jedes falsche Wort eine Waffe sein wird, ihnen die Rede wieder zu entziehen; oder war es die Sprachlosigkeit, die sie mit uns allen teilen; oder haben sie etwa den Weg vom einen zum anderen gefunden?
Sie haben sich nicht von den Pädagogen einfangen lassen, nicht von den Trotzkisten, nicht von den Imamen, sie haben es vorgezogen, niemandem als dem Kärcher zu weichen, und haben der Republik dessen Maschinisten Sarkozy, diesem halb Clown, halb Cavaignac, als Präsidenten aufgezwungen.
Sie haben damit, als letzte von den Akteuren, die Bühne der gegenwärtigen sozialen Kämpfe in Frankreich betreten und gleichzeitig schon die Regeln des ganzen Spiels geändert. Wo sich, seit 2002, eine breite demokratische und reformistische Bewegung entfaltete, unter den prekär Beschäftigten im Kultursektor, unter den Studierenden und Gymnasiast/innen und im öffentlichen Dienst, und wo sich in einer gewissen quälenden Monotonie eine Neuinszenierung aller der honetten, der anständigen, der demokratischen Aspekte des offiziellen 1968 zu entfalten schien, haben sie in Erinnerung gebracht, dass 1968 nicht zu denken ist ohne die Riots in der Rue Gay-Lussac.
Was die sozialen Bewegungen der Jahre vorher, in denen sich rein gar nichts bewegt hatte, so geräuschvoll verschwiegen hatten, ist jetzt zu ihrem Schrecken ausgesprochen. Die Revolte hat keine Forderungen aufgestellt, über die verhandelt werden konnte, sie hat, wie ein Irrlicht, für einen flackernden Moment sich aufgerichtet, und ist wieder verschwunden, ein Gespenst im Morgengrauen; aber sie war da, es gibt keinen Zweifel, und sie hat, ebenso ohne Zweifel, festgestellt, dass entweder sie oder die Ordnung bestehen können, aber nicht beide.
Die wirkliche Spaltung des Proletariats
Die sogenannten sozialen Bewegungen in Frankreich sind Bündnisse von Organisationen, in denen der grössere Teil des Proletariats seine besonderen Interessen in der Weise geltend macht, dass die Kämpfe für die einzelnen, getrennten Interessen auf äusserliche Weise mehr oder weniger zusammenfallen. Diese Strategie gibt den einzelnen Sonderinteressen mehr Gewicht, ohne die Tatsache aufzuheben, dass es sich um getrennte Interessen handelt. Das heisst: ein Teil des Proletariats kämpft einen politischen Kampf um seinen Platz in der herrschenden Ordnung. Die sozialen Bewegungen, weit davon entfernt, die Ordnung zu bedrohen, setzen sie vielmehr voraus. Das ist die Geschäftsgrundlage ihres Bündnisses untereinander und mit dem Staat.
Gegenüber diesem Teil des Proletariats repräsentieren die Jugendlichen aus den Banlieus dasjenige, was die Bewegungen an den Staat verraten haben. Sie haben durch ihre eigenständige Aktion eine wirkliche Spaltung des Proletariats zum Ausdruck gebracht. Die sozialen Bewegungen, die seit 2002 ihre Aktivität immer weiter ausgeweitet haben, sind an eine historische Schranke gestossen: jede weitere Ausdehnung der Aktion hat zur Voraussetzung, diese Spaltung aufzuheben, aber der Preis dafür wäre die Aufkündigung ihrer eigenen Geschäftsgrundlage. Die erfolgreiche Bewegung gegen den Ersteinstellungsvertrag (die Abschaffung des Kündigungsschutzes für Jugendliche) hat das auf eine Weise gezeigt, die unter der bloss politischen Linken für Entsetzen gesorgt haben muss.
Im März und April 2006 haben sich dort, wo Studierende die Aktionsformen der Banlieus übernommen haben, die Jugendlichen der Banlieus ihnen angeschlossen. Dort, wo an den traditionellen Formen des politischen Protestes festgehalten worden ist, haben sie die Demonstrationen angegriffen. Es ist völlig klar, dass die Auseinandersetzung damit an einem Punkt war, wo es gar nicht mehr um den Ersteinstellungsvertrag ging, sondern um die Frage, ob man sich gegen die Ordnung zur Wehr setzt oder ihr angehört.
Die Regierung hat des Gesetzesvorschlag weise wieder fallen lassen, und Sarkozy zieht es vor, die Eisenbahner gegen sich aufzubringen; vielleicht erinnert er sich, dass de Gaulle 1968 mehr als nur einen Kärcher nötig hatte. In der Zwischenzeit hat er paradoxerweise nahezu freie Hand gegen die Gewerkschaften; es scheint, als ob seit 2005 kein Teil des Proletariats mehr sich bewegen könnte, wenn sich nicht das ganze Proletariat bewegt. Das aber werden schon, wohlweislich, die Organisationen des Proletariats zu verhindern wissen.
Revolte oder Pogrom?
Es ist viel Unsinn geschrieben worden über die Revolte von 2005, nicht nur in der offiziellen Presse. Dass etwa ein gewisser Uli Krug glaubt, in der bahamas – in einem Nebensatz – von „pogromartigen Ausschreitungen moslemischer Vorstadtjugendlicher“ sprechen zu müssen: geschenkt. Dass er das in einem Artikel schreibt, in dem er die Bewegung in Frankreich wegen ihrer Anbetung des Staates kritisieren will: äusserst spasshaft. Dass sich so etwas noch „antideutscher Kommunist“ nennt, ist allerdings ein Ärgernis, dem vorerst noch nicht abgeholfen werden kann.(3) Er hätte, wenn er nur gewollt hätte, darauf kommen können, dass es in den fraglichen 3 Wochen weniger antisemitsche Übergriffe als sonst gab. Wenn die Jugendlichen Pogrome vorgehabt hätten, hätten sie welche gemacht, und nichts hätte sie daran gehindert.
Es ist auch gutes und richtiges geschrieben worden. Die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft in Berlin haben eine Broschüre „Rauchzeichen aus den Banlieus“ herausgebracht, die im wesentlichen Texte von unabhängigen linksradikalen Gruppen aus Frankreich enthält.(4) Sie ist uneingeschränkt lesenswert, aber nicht vollständig.
Es empfiehlt sich, den Artikel von Caroline Dubois aus dem „Magazin“ #3 dazu zu lesen; (5) Dubois behandelt den äusserst beunruhigenden Aspekt, dass an den Riots fast nur Männer teilgenommen haben. Das ist eine der wichtigsten Fragen, denn an ihr entscheidet sich, wie Dubois mit aller Klarheit zeigt, der Charakter der ganzen Angelegenheit: nicht, dass die jungen Frauen nicht gewollt haben, man hat sie daran gehindert. Wer aber ja sagt zur Herrschaft zwischen den Geschlechtern, mag wollen oder nicht, er sagt ja zur Herrschaft in allen ihren Formen.
Gegenüber den abgestandenen sozialen Bewegungen vertreten die Riots auf jeden Fall das bessere; gemessen an der Herrschaft, wo sie ihnen in vertrauten Gestalt der Familie und ihrer eigenen Persönlichkeitsstrukur erscheint, bleibt das Bewusstsein ihrer Akteure völlig unzulänglich. Dubois hat völlig recht: „Dadurch transformierte sich die berechtigte Infragestellung der herrschenden Ordnung durch die Jugendlichen in die Berechtigung der herrschenden Infragestellung der Jugendlichen durch die herrschende Ordnung. Mit anderen Worten: Die Jugendlichen haben gezeigt, daß sie die Niederschlagung ihres Aufstandes verdient hatten.“
Mögen sie es das nächste Mal nicht mehr verdienen: sie haben uns gezeigt, wie man Feste beleuchtet; mögen sie uns auch noch zeigen, wie man sie feiert.
Jörg Finkenberger
1 Sarkozy hatte bei den Riots von 2005 erklärt, er werde die Strassen von der Racaille (=vom Gesindel) mit dem Kärcher (=Hochdruckreiniger) reinigen.
2 Sie haben in 3 Wochen 28.000 Autos angezündet, in ihren eigenen Wohnviertel, sie haben Kirchen und Schulen zerstört, Fabriken abgebrannt, kurz und gut, alles, was brannte und allgemein, gegen jede Vernunft, als nützlich und gut gilt. Sie haben, ausserdem, als erste in der bisherigen Geschichte, die Waren in den Geschäften nicht geplündert, sondern zerstört, wie wenn sie wüssten, dass die Waren weniger als nutzlos sind. Habe ich gesagt, wie wenn sie wüssten? Sie wussten es natürlich, es kann niemandem verborgen bleiben. – Unlesbar sind die Chiffren für die Herrschaft. Für uns sind sie gut lesbar.
3 „Dadaist kann sich jeder nennen, dafür, dass man auch dafür hält, muss er selbst sorgen“ (Raoul Haussmann). Das gilt im Prinzip auch für den Begriff antideutsch. Vielleicht ist die Schande, die man empfinden muss, wenn man solche Leute mit solchen Worten hantieren sieht, ein genügender Antrieb, mit der Spaltung der antideutschen Strömung ernst zu machen.
4 http://www.klassenlos.tk/data/pdf/rauchzeichen_aus_den_banlieues_texte_2_auflage.pdf
5 http://www.magazinredaktion.tk/h3-dubois.php