Eine Polemik
Als noch die Zimmermanns-Sekte am Wittelsbacherplatz bestand, hatte ich ein Problem mit den LiebhaberInnen der Kritischen Theorie, die immer bereit waren die besagte Theorie an jeder Ecke zu predigen, aber anscheinend ratlos waren, wenns ums praktische ging. Ist ja eine Theorie, keine Praxis, zudem ist ja bekanntlich kein wahres Leben im Falschen und ihr wisst schon… Nun, Mittelschichtskinder, die sich gerne auf Adonro berufen, begegnen mir immer wieder. Verwiese auf Adorno sind meistens kritiklos, tatenlos und affirmativ ohne Ende. Sicher kann mensch die so genannte Kritische Theorie auch unterschiedlich lesen und auslegen, wie so ziemlich alles, aber es gibt Gründe meiner Meinung nach, die dafür sprechen, Adrono-Konsum mal drastisch zu reduzieren. Dies soll keine Abrechnung mit der Kritischen Theorie sein oder mit ihren Fans. Aber ein Anstoß zur Auseinandersetzung mit ihr.
1. Wie gesagt, ich persönlich vermute bei einigen Adorno-Fans einen Wunsch nach feinem Zeitvertrieb: die Sprache ist hochgestochen und komplex, das großbürgerliche Nörgeln kommt immer wieder zum Vorschein (klassische Musik hat eh, glaube ich, nur die „Bildungsnahen“ angesprochen), und das gute und schmerzende Gefühl vor allem, sich kritisch mit dem Bestehenden auseinander zu setzten, aber nichts tun zu müssen. Sonnst hört womöglich auch diese feine Beschäftigung auf, sonnst kann mensch nicht mehr punkten mit Verweisen auf geistreiche Literatur. Außerdem kann mensch ja nichts gegen diese Gesellschaft machen. Aus meiner Underdog-Perspetkive, die ich, ehrlich gesagt, mal gerne raushängen lasse, erinnert mich das an jene deutsche Bürger, die „ihren Marx ja auch gelesen haben“ und das ganze sogar schön und richtig finden, haben jetzt aber „so einiges zu verlieren“. Übrigens, so weit ich weiß, geht es Anhängern Evolas oder Blavatskys genauso, sie leiden auch gerne auf hohem Niveau an dieser Welt. Dieses Leiden dient ihnen als Beweis ihrer seelischen Schönheit. Ich bin nicht imstande eine fundierte marxistische Kritik an „Adornismus“ (wie es M.Creydt im Aufsatz „Glanz und Elend der kritischen Theorie“ nennt) zu liefern, aber ich würde Creydt zustimmen: „das feinsinnig gebildete Subjekt“, das sich stets bemitleidet, ist wohl ein schlechter Ausgangspunkt für eine andere Welt. Für alle Gegebenheiten des Lebens finden Adorno-Fans das passende Zitat aus den Werken des Meisters, auf dieselbe Weise bedienen sich brave Bürger, die noch keine Zeit in die Kritische Theorie investiert haben, gewöhnlich mit Zitaten aus Hermann Hesse.
2. In seinem wohl bekanntesten und einflussreichsten Werk „Dialektik der Aufklärung“, entwickelt er gemeinsam mit Max Horkheimer eine grundlegende Kritik der Vernunft und somit der ganzen Zivilisation. Sie behandeln in Fragmenten verschiedene Stationen der europäischen Kulturgeschichte von der griechischen Antike bis zur gegenwärtigen Industriegesellschaft und versuchen zu zeigen, warum die Aufklärung misslingen und in eine neue Barbarei umschlagen musste. Die menschliche Vernunft, der natürliche Wille zur Selbsterhaltung bringen ausweglos Herrschaft und Entfremdung hervor. There is no alternative – so scheint es. Und das fasziniert anscheinend die Konsumenten dieses Werkes. Außer dem, dass es zwei Menschen des 20. Jahrhunderts sind, die die Mythen in einer besonderen Weise auslegen, und dass sie eigentlich bei ihrer anthropologisch anmutenden Analyse nur auf die Geschichte des Abendlandes beschränkt bleiben, kann Creydt in den Adorn`schen Denkfiguren große Löcher ausmachen. Ob es um die Herrschaft der Abstraktionen oder um instrumentelle Vernunft geht, vergessen Adorno und Horkheimer gerne, dass diese Phänomene durchaus (im marxistischen Jargon) transzendierungsfähig. Reale und komplexe Zusammenhänge werden totalisiert und tautologisiert. „Auch hier gerät die Erklärung zur Ideologie, insofern sie sich am Schein orientiert, das Phänomen sei als selbständig und unabhängig aufzufassen“, so Creydt. Obwohl sie Produktionsverhältnisse ab und zu mit den altgriechischen Mythen reimen, vergessen sie die konkreten Umstände im Kapitalismus zu analysieren. Oder sie halten ihn einfach für selbstverständlich: das böse Tauschverhältnis genau wie die böse kapitalistische Rationalität war dem Menschen in die Wiege gelegt.
Die Denkweise hat auch interessante NachahmerInnen gefunden. Das sind zum einen gewisse K-Gruppen, „Antideutsche“, die alles Mögliche an der Shoa und am Nazional-Sozialismus messen und sie zu einer Art „negativer Theologie“ machen, statt das Grauen in seiner Komplexität angemessen zu analysieren. Das sind auch die heute in den USA modischen Anarcho-Primitivisten, angeführt von John Zerzan. Diese wiederum von Adorno die scheinbar fundamentale Kritik an der instrumenteller Vernunft übernommen, wollen abstraktes Denken, Schrift, Sprache, sprich den Menschen selber abschaffen. Dann ist auch alles Schlechte aus der Welt verschwunden. Das einzig Lobenswerte daran ist: zumindest die haben Adorno konsequent zu Ende gedacht und eine Lösung gefunden. Mir ist noch eine Leseweise bekannt, nämlich die des einen leider nicht sehr bekannten Adorno-Schülers Helmut Thielen: dieser hat in seine böse menschliche Vernunft eine irrationale Bremse installiert – die der Befreiungstheologie und der Liebe Christi. Ein Marxist, der sich zum Anarcho-Kommunismus als Praxis und zum Christentum als permanenter Korrektive der Praxis bekennt, wird vielleicht Einigen verdächtig erscheinen, aber meines Erachtens ist Thielen der einzige der Adornos Erben, der mit seinem Lehrer in einer überzeugender Weise fertig wird.
3. Der fundierten Kritik von Creydt will ich noch einige Kleinigkeiten beisteuern. Creydt weist darauf hin, dass Adorno und Horkheimer in der „Dialektik der Aufklärung“ auf komplexe Analysen des Bestehenden verzichten, um die vermeintliche Totalität kritisieren zu können, sonst wäre die „tief greifende“ Kritik nicht aufrechtzuerhalten. Die beiden waren Marxisten (was manche Fans aus dem guten Hause ausblenden), „das Tauschprinzip“ als Hauptprinzip allen Geschehens und sonstige Anspielungen auf den Kapitalismus, der anscheinend schon immer im Metaphysischen über der Menschheit schwebte, tauchen nicht umsonst so regelmäßig auf. Todd May gibt zwar zu, dass Horkheimer und Adorno sich von den revolutionären Hoffnungen und strategischen Überlegungen Lenins weit entfernt haben, gedanklich haben sie doch etwas nicht zu unterschätzendes gemeinsam. Das nennt May „strategische politische Philosophie“: ein Kampf, eine Theorie, eine Avantgarde. Die Wende zum „cultural capitalism“ ändert nichts an der immer noch marxistischen Gesellschaftsanalyse. Angesteckt mit dem Tauschprinzip ist alles und zwar in einer Weise, die keine Differenzierungen mehr kennt. Wozu denn unterscheiden, wenn alles eh ein Teil vom bösen Ganzen ist? Der einzig richtige Kampf mit dem einzigen richtigen Feind (Kapitalismus) fand nicht statt, da die einzige dafür taugliche Klasse sich korrumpieren ließ. Als Marxisten MUSSTEN Horkheimer und Adorno resignieren – durch das strategische Denken des Marxismus determiniert. Desweiteren zeigt May, wie Habermas, Althusser, Negri diese Einschränkung ihrer politischen Philosophie umzugehen versuchten, aber immer daran scheitern mussten, dass ihr revolutionäres Subjekt sie im Stich ließ. Auch Autonomist Castoriadis entkommt dem Problem nicht ganz, trotz des Bruches mit Marxismus. (Ohne Vorschläge kann May das natürlich nicht so stehen lassen: er will das dem Anarchismus eigene taktische politische Denken noch mit Poststrukturalismus bestärken und radikalisieren).
4. Der nächste Punkt, an dem ich rütteln will, ist ganz entscheidend – es ist das anthropologische Fundament der strategischen Philosophie, das gerade bei Horkheimer und Adorno eine so wichtige Rolle spielt. Das ist die Angst vor der Natur, die die Vernunft zwingt, Wege zu suchen, sich von der „Herrschaft der Natur“ zu befreien. Was dann zwangsläufig zum Zivilisationsschlamassel führt: Herrschaft geht nur über das Entfremden. Dem würden AnarchistInnen zustimmen, der entscheidende Gedanke aber im „Adornismus“ ist: Es ging nicht andres. Der Begründer der Sozialen Ökologie, Murray Bookchin, stellt das angenommene Verhältnis Mensch / Natur auf den Kopf, mit weit reichenden Konsequenzen. „…(D)ie Herrschaft des Menschen über den Menschen (ist) der Vorstellung von der Naturbeherrschung vorausgegangen. Die menschliche Herrschaft über den Menschen ließ den Gedanken, die Natur zu beherrschen, überhaupt erst entstehen“. Bookchin sammelt Beweise dafür, dass „primitive“ Gesellschaften von Solidarität nach innen und nach außen – mit der Natur – geprägt waren, daher sahen sie Dinge, Menschen und Beziehungen „in ihrer Einmaligkeit“ und nicht in einem hierarchischen Verhältnis zu einander und kamen sie nicht auf die Idee, die Natur zu beherrschen. Hier kann es nicht darum gehen, die ganze Argumentation Bookchins mit all ihren Facetten wiederzugeben. Die Sache ist: die „organische Gemeinschaft“ verformt sich durch Hierarchien, die nicht aus der ökonomischen Notwendigkeit resultierten und, folglich, nicht aus der kalkulierenden Vernunft. Die Vorstellung, dass die Naturbeherrschung die Herrschaft über Menschen „erfordert“, „voraussetzt“ oder „umfasst“, diente schon immer der Rechtfertigung der Menschenbeherrschung. (Herrschaft ist ein gesellschaftlicher Begriff und entsteht nicht in der abstrakten „Vernunft“). Bookchin ist klar, dass er sich in einer gefährlichen Nähe zur Romantisierung der „primitiven“ Gesellschaften und somit zum Anarcho-Primitivismus befindet. Die ganzen anthropologischen Daten können von uns unterschiedlich ausgelegt werden (genau wie die Odyssee, übrigens). Bookchin rettet aber die Vernunft ohne sie mit der kapitalistischen „Rationalität“ gleichzusetzen, und mit ihr die Möglichkeit, dass der Mensch seine Evolution sinnvoll steuern kann.
5. Meines Erachtens fußt Adornismus auf falschen Prämissen. Aus falschen Prämissen kann mensch nichts Wahres ableiten – das besagt die formale Logik (tut mir Leid, ich konnte es nicht verkneifen). Für eine treffende Diagnose unserer Zeit, für eine Kritik der Kulturindustrie braucht mensch keine pessimistische Anthropologie und kein großbürgerliche Resignation. Für eine Veränderung in der Welt braucht mensch sie noch weniger. Adorno kann aber nichts Anderes. Er verbarrikadierte sich jede Möglichkeit, das Andere anzudeuten, daher bleibt er affirmativ, um den Jargon der Kritischen Theorie zu bemühen. Daher auch meine These: Wer eine radikale Veränderung der Gesellschaft anstrebt, findet bei Adorno weder das passende begriffliche Instrumentarium noch eine Ermutigung. Überlasst diesen schönen Zeitvertrieb denen, die einfach „vorsichtiger bzw. bewusster konsumieren“ und das noch theoretisch untermauern wollen.
Ndejra
Quellen:
Bookchin, Muray: Die Ökologie der Freiheit, 1985 und Die Neugestaltung der Gesellschaft, 1992
Creydt, Meinhard: Glanz und Elend der kritischen Theorie, http://www.grundrisse.net/grundrisse08/8kritische_theorie.htm
May, Todd: The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism, 1994
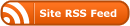
One Response
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.
Continuing the Discussion