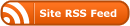„Wir zahlen nicht für eure Krise!“ hechelt ein Sammelsurium aus Gewerkschaften, Parteien und linken Gruppen und ruft zu großen Demonstrationen für die viel beschworene und diffus-bestimmbare solidarische Gemeinschaft auf. Was die Reststücke dieser links Fühlenden vereint ist ihre Begriffslosigkeit, ihr Mangel an Kritik der kapitalistischen Kategorien und der unbedingte Wille, eine linke Krisenbewältigung via Rekeynesianisierung, also durch den Staat als vermeintlichen autonomen Agenten, einzufordern.
Der gemeinsame Aufruf zu den Demonstrationen in Berlin und Frankfurt am 28. März beweist auf ein neues, dass die Krise auch eine Krise der Linken ist. Der Aufruf ist ein Zeugnis des diffusen Mix‘ aus bürgerlicher Staatsauffassung und nie überwundenen Konzeptionen des ökonomistischen Basis-Überbau-Theorems. „Die Entfesselung des Kapitals und der erpresserische Druck der Finanzmärkte haben sich als zerstörerisch erwiesen“ meint der Aufruf, wobei zugleich suggeriert wird, jene Entfesselung sei nicht in der Logik der Wertverwertung selbst angelegt und sei durch eine Sphäre der Einfachen Warenproduktion in Verbindung mit einem autonomen Staat zu einer freien Gesellschaft umkehrbar. Man möchte, dass „Bildung, Gesundheit, Alterssicherung, Kultur und Mobilität, Energie, Wasser und Infrastruktur nicht als Waren behandelt werden“ und begreift anscheinend nicht, dass gerade Begriffe wie Gesundheit, Bildung und Kultur in der kapitalistischen Gesellschaft negativ gefasst sind und die Bedingung der Reproduktion der Ware Arbeitskraft sind, es sei denn man würde sich vom Kapitalismus in emanzipatorischer Weise befreien. In nahezu jeder Formulierung der Aufrufs schwingt die Sehnsucht nach dem guten alten Keynesianismus mit, in dem das Kapital noch Nation vermittelt war, und man tatsächlich noch von einer Volkswirtschaft in Verbindung mit der sich damals schon im Niedergang befindenden Realakkumulation sprechen konnte. „Die Regierungsberater, Wirtschaftsvertreter und Lobbyisten sind nicht vor Scham im Boden versunken, sondern betreiben weiter ihre Interessenpolitik. Um Alternativen durchzusetzen, sind weltweite und lokale Kämpfe und Bündnisse (wie z.B. das Weltsozialforum) nötig – für soziale, demokratische und ökologische Perspektiven.“ Hier kommt klar die Unfähigkeit zum Ausdruck, den Staat als politische Form der kapitalistischen Gesellschaft zu betrachten. Stattdessen wird einerseits in den Kategorien der bürgerlichen Staatskonzeption gedacht- denn der Staat wird als eine allgemeine Instanz betrachtet, die mit der Wertverwertung an sich wenig zu tun hat und sich selbstständig entfaltet, während gesellschaftliche Veränderungen als Kampf zwischen verschiedenen Interessengruppen um die Staatsmacht wahrgenommen werden- andererseits sieht man den Staat durchsetzt von Agenten des Kapitals, die den Niedergang der Gesellschaft betreiben- was eher daran erinnert, den Staat in ökonomistischer Weise als eine bloße Überbauerscheinung seiner kapitalistischen Realität zu begreifen. Die Forderungen der Demonstration sind, gelinde ausgedrückt, eher gruselig. Man appelliert- wenn man schon nicht selbst die Staatsmacht erobern kann- an die Regierung, die Verursacher der Krise zu Bestrafen. Man ist „Dafür, dass die Profiteure die Kosten der Krise bezahlen“. „Die Steueroasen sind endlich zu schließen; Banken, die dort arbeiten müssen bestraft werden.“ Man appelliert an einen starken Staat und unterscheidet sich dabei grundsätzlich nicht von den Forderungen des Staatsoberhauptes.
Was in den zahlreichen Forderungen an den Staat zum Ausdruck kommt, ist im Grunde genommen zweierlei: Zum einen die Absage an die Marx’sche Kritik der Politischen Ökonomie und zum anderen der Beweis, dass man anscheinend kein angemessenes Verständnis der Krise besitzt. Der Staat soll eine konsequente Krisenbewältigung bewerkstelligen. Jedoch hängt der Realitätsgrad des Staates auch, wie es Agnoli treffend skizzierte, von seiner „Fähigkeit, Befreiungsbewegungen und die Tendenz zur Freiheit einzudämmen und zu neutralisieren“ ab. Der Staat soll dafür sorgen, die Reproduktion der Ware Arbeitskraft wieder herstellen zu können. Damit einher geht eine Absage an die Überwindung der staatlichen Herrschaft seitens der Linken einerseits und ein mangelndes Verständnis der Verhältnisses von Ökonomie und Staat andererseits. Die Perspektivenwahl der Politik erfolgt nicht, wie der Aufruf zur Demo glauben lassen will, nach dem freien und autonomen Ermessen der Politik, sondern auch nach dem Druck in der Akkumulation. Dadurch, dass die Wertverwertung durch die Produktivkraftentwicklung mit dem Ende des Fordismus in eine schwere Krise geraten ist, verließ das Kapital mit der dritten industriellen Revolution seinen nationalen Rahmen, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein. Der Staat als Reproduktionsverwirklicher trat in eine Krise, die durch Hartz IV und Konsorten erst begonnen hat. Die Transnationalisierung des Kapitals wird von der Linken nicht als Folge der krisenhaften Wertverwertung aufgefasst, sondern ebenso wie vom bürgerlichen Alltagsverstand als von gierigen Managern und ihren politischen Agenten herbeigeführte Krise, die mit einem Rückgriff auf einen starken Staat bewältigt werden könne. Skizzenhaft wird in die Diskussion der Linken immer wieder Marx eingebracht, ohne seine Kategorialkritik an Staat, Ware und Wert zu begreifen.
Dabei stellt sich die Frage, ob eine kommunistische Begierde, die die bürgerlichen, aber auch die staatskapitalistisch-sozialistischen Aprioritäten hinter sich lässt, in der Krise die Chance hat, zum Vorschein zu kommen. Klar müsste dabei sein, dass mit dieser Begierde nicht die Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand, die panische Massenstimmungen anscheinend als revolutionäre Situation betrachtet und die die damit verbundene Gefahr, hinter den Kapitalismus in die Barbarei zurückzufallen, beinhaltet, gemeint ist. Von jener Kategorialkritik ist weit und breit nichts zu sehen. Jeder Versuch, sie zu formulieren, sie sogar in das Spannungsfeld zwischen Spontaneität und Theorie zu bringen, ist solange zum Scheitern verurteilt, wie mit den Begriffen an die alte Linke angedockt wird und versucht wird, Menschen etwas zu erklären, die anscheinend von nichts einen Begriff haben. Selbst diejenigen anarcho-syndikalistischen und antinational-kommunistischen Gruppen, denen man eine emanzipatorische Restvernunft zusprechen kann, schaffen es schwer, sich von der staatsaffirmativen Linken zu distanzieren und laufen zum Beispiel am 28. März in einem sozialrevolutionären Block auf der besagten Demonstration. Zum anderen bleibt ihre Sehnsucht der Zerschlagung von Staat.Nation.Kapital (Aufruftext) solange eine Randerscheinung, wie die Gruppen nicht fähig sind, die Sprache der alten Linken zu verlassen und damit nicht mehr zu klingen wie ein Aufruftext aus den Zeiten, in denen man noch einen Begriff davon hatte, was Links ist und was nicht. Sich als antinationale KommunistInnen gegen das Ganze zu stellen, müsste bedeuten jeden Versuch von Organisation hinter hinter sich lassen. Denn jedem noch so kümmerlichen Versuch, sich bürgerlich-interessengruppenspezifisch zu organisieren, wohnt bereits die Konterrevolution inne, kriecht der Staat, schlimmer noch, die Nation, in die Struktur. Dazu folgerte bereits der Rätekommunist Paul Mattick: „Hier, in der Frage der Organisation, offenbart sich das Dilemma der Radikalen: Um gesellschaftliche Veränderungen zu bewerkstelligen, müssen Aktionen organisiert werden; organisierte Aktionen aber nehmen immer auch Züge dessen an, wogegen sie sich richten. Es scheint, als könne man immer nur das Falsche oder, aus Angst vor dem Falschen, gar nichts tun. Selbst eine oberflächliche Betrachtung organisierten Handelns offenbart, daß alle bedeutenden Organisationen, gleich welcher Ideologie, den Status Quo stützen […]“.Die Lösung der RätekommunistInnen war die Spontaneität der ArbeiterInnen. Ohne eine Fetischkritik wird jener Hoffnung auf die Spontaneität jedoch schnell zu jener befürchteten Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand in Verbindung mit einer barbarischen Massendynamik, denn auch den meisten ArbeiterInnen stellte sich der Staat bisher als Erhalter seiner Reproduktion dar, und nicht als Aufrechterhalter ihrer Unterdrückung. Eine emanzipatorische Nicht-Organisation muss fähig sein, den oben bereits skizzierten Widerspruch von Kritik des Wesens und Spontaneität beziehungsweise Sabotage auszuhalten. Die ArbeiterInnen müssten, „um persönlich zur Geltung zu kommen, ihre eigene bisherige Existenzbedingung, die zugleich die der ganzen bisherigen Gesellschaft ist, die Arbeit, aufheben. Sie befinden sich daher auch in direktem Gegensatz zu der Form, in der die Individuen der Gesellschaft sich bisher einen Gesamtausdruck gegeben, zum Staat, und müssen den Staat stürzen, um ihre Persönlichkeit durchzusetzen.“ (Wer wohl? Marx)
Betrachtet man die Krise in ihrem historischen Kontext, so stellt sich klassedynamisch und staatlich einiges anders dar als in vergangenen Krisen (wobei die ökonomische Realität beweisen wird, ob es sich bei der aktuellen Krise und eine zyklische oder um eine, in wertkritischer Manier gesprochen, Zusammenbruchskrise handelt). Es ist davon auszugehen, dass der Staat die gesellschaftliche Reproduktion nur dann trägt, wenn er selbst ökonomische Potenz ist, wenn er seine eigene national-ökonomische Basis beinhaltet. Das Kapital hat jedoch längst den nationalen Rahmen verlassen, um der Krise der Realakkumulation zu entgehen. Man kann von keinem Unternehmen von Größe sprechen, das die Grenzen der Volkswirtschaft nicht verlassen musste, um seinem Untergang zu entgehen. Und so müsste der Staat in jenen Krisenzeiten das Rad Richtung Keynesianismus zurückdrehen, was die Realität der Krise von abstrakter Arbeit, Wertverwertung und die Fixierung des Kapitals auf fiktives Kapital schwer möglich machen wird, es sei denn man nähme eine Forcierung der Krise in Kauf und schafft es, die Ideologisierung von Nation und Volk auf ein barbarisches Maximum zu hieven. Dabei tut sich die Frage auf, was mit den ArbeiterInnen passiert, wenn der Staat nicht mehr dazu fähig ist, als Bewahrer der Reproduktion in Erscheinung zu treten? Wenn der Staat seit Jahren, genötigt durch die Anpassungen an die Umwälzung der ökonomischen Struktur, seinen Nutzen als Ermöglicher von Reproduktion verloren hat und auch so schnell nicht mehr zurückerobern kann? Mehr als das: es scheint, als sei ein großer Teil des sogenannten Subproletariats gar nicht mehr in der „Genuss“ der autoritären Vollzeitbeschäftigung namens staatlich-schulische Sozialisation gekommen. Droht dann die Fixierung der Bevölkerung auf barbarische Formen der Krisenlösung in Form von Religion, antisemitischem Wahn und Racketbildung? Auch in klassenstruktureller Hinsicht unterscheidet sich die Krise von zurückliegenden Ereignissen. Der Postfordismus hat die traditionelle Arbeiterklasse zersetzt, um bei der sogenannten Mittelschicht und dem akademischen Milieu weiterzumachen. Was so diffus als Prekariat bezeichnet wird, erfasste die Gesellschaft als Ganzes. Der Klassenkampf als Beschwörungsformel der Linken ist nichts anderes als ein atavistischer Begriff geworden, dem man keine Chance auf Vermittlung mehr unterstellen kann. Wenn weder Staat noch die Klasse Chancen haben, den Kapitalismus zu retten oder als Retter für sich aufzutreten, so kann man den Umschwung in die Barbarei befürchten.
Jedoch: Wenn sowohl akademisches Milieu als auch Arbeiterschaft, vor allem aber das „abgehängte Prekariat“ den Staat nicht mehr als Problemlöser wahrnehmen können, weil alle in der gleichen Scheiße sitzen und dies auch so wahrgenommen werden könnte, wäre dann die Zeit der Verbindung von Spontaneität und Kategorialkritik gekommen? Wäre es dann möglich, ein kommunistisches Ziel zu formulieren, das sich nicht auf die bürgerlichen Aprioritäten einlässt, weil diese Ihren Bedeutungsgehalt längst verloren haben?
Wir können es noch nicht wissen.
Benjamin Böhm