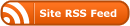1.
Dass dieses Leben, das wir führen, keines ist, ist mittlerweile hinlänglich bewiesen. Und ebenso klar ist, dass die Mittel dafür vorhanden wären, die tägliche Degradation hinter sich zu lassen und etwas neues anzufangen, der niemals endenden Zumutung einen Angriff entgegenzusetzen, der überraschend sein könnte, weil er unberechenbar wäre.
Alles, dessen es bedürfte, wäre, die Lethargie abzuschütteln, die uns freilich in ihrem Würgegriff hält; jeder Widerstand gegen die unfassbare Stummheit des Zwanges realisiert sich unter diesen Verhältnissen in der Selbstzerstörung. Die erstaunliche Stabilität der gesellchaftlichen Herrschaft hat kein anderes Geheimnis: wer sich unfähig fühlt, sich ihr anzupassen, ist damit noch lange nicht unerschrocken genug, ihr wirklich zu widerstehen.
Noch das Bewusstsein der Unerträglichkeit bewegt nicht, es lähmt. Und je klarer das Bewusstsein, desto gefährdeter das Überleben. Die Isolation der Einzelnen verdichtet sich, wo sie bewusst und schmerzhaft wird, zur völligen Einsamkeit. Und noch in unserer Mitte kann man sehr einsam sein.
2.
Natürlich müsste man nämlich Konsequenzen ziehen, und natürlich könnte man das auch. Wir hätten in der Tat nichts zu verlieren als unsere Ketten, aber wir hätten eine Welt zu gewinnen. Lieber aber ertragen wir unser so genanntes Leben, mit einer Attitude, die unseren Kollegen in den Fabriken gar nicht mehr so unähnlich ist: die erzwungene Bohemität unserer Existenz mit Stolz, statt mit Abscheu, zur Schau stellend, in den eigenen Beschränkungen uns mit Stolz einrichtend; wir klammern uns noch an die ödesten Tröstungen, mit dem sicheren Bewusstsein, dass, wer sich daran nicht mehr festhalten kann, abstürzen wird.
Nichts liegt den Verzweifelten ferner als die gemeinsame Aktion. Das letzte, weil unwiderlegliche Argument ist immer dies, dass alle anderen sicher nicht mitmachen würden. Man muss sie sich doch nur einmal anschauen! Und in der Tat. Aber die Isolation wird damit im selben Akt, in dem sie als zu zerbrechend erkannt wird, heilig gesprochen.
Dieses Produktionsverhältnis der Lethargie nenne ich die Szene. Diese Szene als Lebensweise ist als erstes abzuschaffen; der falsche Frieden, der ihr Betriebsklima ist, ist aufzukündigen. Sie ist nichts anderes als das Verhältnis, in dem Vereinsamte zueinander stehen, wenn sie sich in dem dürftigen Rest von Leben, das sie führen, bestätigen; sie ist, als unbedingt konterrevolutionärer Faktor, insofern eine staatsnotwendige Einrichtung mit unbestreitbarem pädagogischem Wert.
Nicht alle sind übrigens verloren, man kann auch aus der Szene heraus die Integration in die bürgerliche Geschäftswelt erlernen, denn sie ist selbst nach der Logik der Ware geordnet; eine blosse Filiale der Gesellschaft, mit ihrer eigenen Hierarchie und ihren eigenen Intrigen; sogar die Kunst, das Theater, jede falsche Münze ist hier noch in Kurs. Die Szene erweist sich so als in allen Punkten unter dem Niveau ihrer Zeit, nur nicht in dem einen, dass sie vollkommen ohne jedes Gedächtnis ist.
Es sagt viel, dass Punk heute unter der Rubrik Jugendkultur verwaltet werden kann, und dies offensichtlich nicht Lüge genug ist, als dass gegen eine solcher Erniedrigung handgreiflich vorgegangen würde.
3. Was hat die Welt uns noch zu bieten? Wenn dies kein Leben ist, das wir führen, was hindert uns, das unsere da zu suchen, wo man es nicht vermutet, und wo man nicht vorhersieht, dass wir es suchen? Das Proletariat hat in der Vergangenheit aus diesem Paradox seine Revolten gemacht. Wer garantiert, dass nicht hier ein Punkt liegt, von dem aus an diese Revolten anzuknüpfen wäre?
Worin, ich habe es nicht begriffen, besteht die besondere Notwendigkeit, zu lernen und zu arbeiten, damit man sich einen Plasmafernseher kaufen kann? Kompensiert die Erniedrigung, vom Fernsehprogramm für einen Idioten erklärt zu werden, die Erniedrigung, durch die Arbeit tatsächlich zum Idioten sich zu machen? Warum ein Studium auch noch bezahlen, wenn man dadurch im besten Falle zu einem Lehrer oder zu einem Anwalt wird? Die Knechtschaft der Lohnarbeit setzt uns in den Stand, uns nichts anderes als Waren zu kaufen: aber gibt es, was wir brauchen, auf dem Markt?
Nicht einmal plündern möchte ich diese Städte. Sie haben nichts, was zu irgend etwas nütze ist. Die Schaufenster locken mich nicht, ich habe nie etwas gekauft, das keine Unverschämtheit gewesen wäre. Das sind die Produkte dieser Menschheit: nutzloser Schrott. Das ist der Inhalt ihrer Arbeit. Wenn ich riskiere, dies alles zu verlieren: was riskiere ich?
Alles könnte möglich sein, jede Drohung hätte ihren Schrecken verloren.
4. Aber der Schrecken, den uns die Verhältnisse einjagen, bleibt uns, als ein Mal der Gewalt. In ihm macht sich auf verdrehte Weise die Wahrheit geltend, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist; Freiheit für die Einzelnen wäre nur möglich in einer befreiten Gesellschaft, denn die wirkliche falsche Gesellschaft duldet kein Leben neben sich.
Die abstrakte Stärke, nichts zu verlieren zu haben, erweist sich als wirkliche Schwäche, ja als Schatten der Katastrofe; diejenigen, die nicht einverstanden sind, sind gezeichnet.
Der Druck nimmt zu, und es sind zunächst die bewusstesten, die an ihm zerbrechen; die anderen können sich noch eine Weile die Illusion machen, dass es noch einen Weg zurück gäbe, und manche mögen ihn auch finden; um diese ist es uns nicht schade. Der Weg, den wir gehen, nicht weil wir ihn gewählt haben, sondern weil es an einem bestimmten Punkt keinen anderen gegeben hat, führt aber nur in eine Richtung, und von den vielen Möglichkeiten bleibt nur noch eine.
Was hat solche Gewalt über uns, und das zu nehmen, was uns doch möglich wäre? Wieso erscheint der Suizid als derartig konsequent? Wieso, in einem Satz, geht einer von uns eines Tages aus dem Haus und springt von einer Brücke?
Dieses entsetzliche Rätsel macht uns hilflos, weil es unsere wirkliche Hilflosigkeit auf den Punkt bringt: nichts unterscheidet uns nämlich von ihm, und sein Tod hat ein Urteil über unser Leben gesprochen, das wir nicht mehr widerlegen können. Ich wünschte, nur dies eine Mal, dass er Unrecht gehabt haben könnte: aber ich sehe es noch nicht.
Der Schluss, den er getroffen hat, macht mich ratlos; die Voraussetzungen aber kann ich nicht bestreiten. Ja, es lohnt sich nicht, dieses Leben zu führen. Und die Mittel, es zu ändern, liegen nicht in unserer Hand. Die Konsequenz daraus macht mich irre, weil ich sie nicht will. Aber sie ist gezogen. So weit ist es gekommen.
5. Ausgerechnet dieser eine wird nicht mehr bei uns sein. Der bürgerliche Zynismus hat den Satz erfunden, dass das Leben weitergeht: aber was für ein Leben? Dass alles weitergeht, das ist die Katastrofe.
Nichts ist mehr unschuldig. Alles harmlose ist verächtlich. Oberflächliches Gelaber. Unerträgliche Scheisse. Die bisherige Szene ist unmöglich geworden, von einem Tag auf den anderen.
Aber wir betreiben sie immer noch, wie wenn nichts gewesen wäre. Und in der Tat: war denn etwas? Das Weiterbestehen der Dinge sagt: es ist nichts gewesen. Wenn wir, und sei es nur dies eine Mal, etwas dagegen geltend machen wollen, dann, und sei es nur aus einem Rest von Selbstrespekt: zerbrecht eure Gefängnisse, es ist höchste Zeit, nein, es ist schon darüber hinaus.
Es ist Zeit, dass Konsequenzen gezogen werden, andere, als er sie gezogen hat, aber Konsequenzen. Es ist Zeit, dass wir uns unsere Leben zurückholen, und wenn wir dafür durch das Land unserer Selbsttäuschungen zurück wandern müssen. Es ist nötig, sich darüber klar zu werden, dass alles, womit wir es schaffen, zu ertragen, was nicht zu ertragen ist, uns nur stumm gemacht hat und wehrlos.
Die Macht, die die Gesellschaft nach allem über uns hat, besteht darin, dass die Einzelnen ihren Zwang an sich selbst vollstrecken. Und ihr Urteil über die Auflehnung ist, dass sie nicht sein soll. Nichts, was wir bisher getan haben, geht darüber hinaus.
Sich dem nicht beugen, was über uns verhängt ist, hiesse, auch von den teuersten Illusionen Abschied zu nehmen und wirklich unberechenbar zu werden. Nichts garantiert, dass unsere Unruhe das Vorzeichen kommender Unruhen wird; garantiert ist nur, was aus uns wird, wenn es weitergeht wie bisher.
Jörg Finkenberger