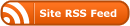(hier wird ein Artikel aus dem letzten Hype Nr. 14 nachgereicht:)
Wenn sie nur noch tanzen können, ist das keine Revolution
Von antideutschen Fanmeilen und dem Verlust der radikalen Lebenswirklichkeit
Raven gegen Deutschland. Hunderte zuckende Leiber scheinen den Text zu kennen, wippen im Takt, fühlen sich synthiewohl. Raven gegen Deutschland, an einem Ort namens Posthalle. Es ist interessant, wie sich die Zeiten ändern: Hätte man vor fünf Jahren ein Projekt wie Egotronic in das Autonome Kulturzentrum holen wollen, gewisse Leute wären in schallendes Gelächter ausgebrochen. Zu wenig Publikum, zu linksradikal, zu antideutsch, whatever. Heute veranstalten die selben Menschen, die damals das AKW zugrunde gerichtet haben, in ihrer Posthalle ein Festival mit- wie sollte es anders sein- Egotronic, samt ihrer FreundInnen vom Label Audiolith. Es scheint etwas passiert zu sein, das ich nicht ganz nachvollziehen kann: Linksradikales Parolenrufen wurde in den letzten Jahren zum Chique geadelt, hat die Autonomen Zentren verlassen und findet jetzt selbst an einem gottverlassenen Ort wie Würzburg statt, inklusive hunderter Kids, die die Texte in- und auswendig lallen können.
Be cool- be antideutsch. Es gibt keinen abgedroscheneren Werbespruch, der mir gerade in den Sinn kommt, um die seichte Elektrowelle zu beschreiben, die von Flensburg bis Fürstenfeldbruck Jugendliche in ihren Bann zieht. Niemand kann ernsthaft behaupten, dass es sich bei diesem Phänomen um die Speerspitze einer neuen kritischen Bewegung handelt. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Wer tanzende Elektrokids beim Audiolith-Festival beobachtet, fühlt sich eher an das Grauen der deutschen Fanmeilen zurück erinnert. Und plötzlich schließt es sich nicht mehr aus, dass jemand „Raven gegen Deutschland“ ruft und in ein paar Monaten „Steht auf, wenn ihr Deutsche seid!“. Es besteht ein Zusammenhang zwischen einfach zugänglicher Elektromusik und einfach zugänglichem, alles nach plapperndem Publikum. Würden Egotronic ihre bisherigen Texte durch die Zeilen von Alexander Marcus ersetzen, so würden sich wahrscheinlich nur die Oldschoolfans darüber ärgern. Und man kann noch so viele Versuche unternehmen, das Saufen und PEP-durch-die-Nase-Ziehen mit politischem Gehalt aufzuladen, es bleibt nichts anderes als Saufen und PEP-durch-die-Nase-Ziehen, Wirklichkeitsflucht und Enthemmung eben, wie sie größtenteils auch vom Rest der Bevölkerung dann und wann betrieben wird.
In dem Moment, als aus einer radikalen Richtung ein popkultureller Lifestyle wurde, hat auch das Label „Antideutsch“ voll und ganz seine Bedeutung verloren. Popkultureller Lifestyle bedeutet nämlich: Man hat sich eingerichtet. Man bewegt sich unbeschwert in den Formen der Kulturindustrie, als ob die bürgerliche Gesellschaft eine Klaviatur sei, auf der man locker-leicht das Lied der Emanzipation klimpern könne. Man betreibt ein linksradikales Zine wie das Hate-Magazin, in dem sich gelangweilte GrafikdesignerInnen austoben dürfen, gibt eine ach so kreative Schülerzeitung wie „Straßen aus Zucker“ heraus und rezipiert ein wenig Adorno zur Steigerung der sexuellen Attraktivität. Nichts anderes ist dieser Lifestyle aber als die Flucht in eine wohlige Nische, in der es sich gut Leben lässt. Die Revolution kommt später oder nie, zuerst kommt das Projekt. Und egal wie viele Drogen man am Wochenende konsumiert hat, am Montag ist die Arbeitskraft wieder hergestellt, damit man in die Uni gehen kann, in der Uni lehren kann, in der Schule sitzen kann, im Betrieb schwitzen kann, in der Werbeagentur kreativ sein kann.
Ich weiß nicht, wie oft ich von Kids „es gibt kein richtiges Leben im falschen“ gehört habe. Was wollen sie eigentlich damit legitimieren? Ist es das jämmerliche Leben, dass auch ihre 68er-Eltern führten und das auch sie führen werden? Der Gang durch die Institutionen, diesmal aber nicht mit der naiven Vorstellung, dass man diese von Innen heraus verändern könne, sondern mit der Überzeugung, dass es kein Vita Activa gibt, sondern nur die Einsamkeit der/der KritikerIn? Was die jungen AnhängerInnen des neuen postantideutschen Hedonismus eint ist die feste Überzeugung, dass die Revolution auf später verschoben werden muss und das emanzipatorische Begehren solange im Lustprinzip aufbewahrt werden muss, bis diese Gesellschaft in ein paar Jahrzehnten, in ein paar Jahrhunderten oder nie an ihren Widersprüchen zerberstet. Mir kommt es so vor, als müsse man sich an nichts mehr in ihrem/seinen Umfeld stoßen, weil ja kein richtiges Leben im Falschen gibt. Es ist die postantideutsche Lifestyleszene, die die Dialektik der Aufklärung nicht als Handbuch der Revolution gebrauchen kann, sondern zur persönlichen Erbauung nutzt.
Sie mögen damit glücklich werden, Kiddies die noch zur Schule gehen und bereits jetzt zu wissen scheinen, dass sie den Kommunismus nicht mehr erleben werden, einen postantideutschen Elektrolifestyle leben und ansonsten die Versuche, das Falsche im Falschen zu verhindern, verlachen. Schade ist es um sie nicht. Was linksradikal sozialisierten Kids abhanden kam ist die Ungeduld des revolutionären Begehrens, eine radikale Lebenswirklichkeit, die sich an seinem/ihrem Umfeld und den Lebensformen, die die bürgerliche Gesellschaft anbietet, stößt, anstatt sie als notwendiges Übel anzuerkennen. Dabei ist die Frage zu stellen nach dem Ausgangspunkt der Kritik. Wozu betreiben wir Kritik? Zur Selbstvergewisserung, dass man die Gesellschaft verstanden habe, während die anderen Menschen auf der Linken Seite noch immer im Trüben fischten? Radikale Kritik, die mehr ist als das Jargon der akademischen Seminare, hat bei sich selbst und bei ihrer/seiner eigenen Lebenswirklichkeit anzufangen. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang von Lebenswirklichkeit und Kritik. Kritik taugt zu nichts, wenn hinter ihr nicht das Begehren steckt, das eigene geknechtete, unwürdige Leben hinter sich zu lassen. Die Einforderung des schönen Lebens, und zwar jetzt und sofort, ist eine notwendige Bedingung jeder Kritik, die in den letzten zwanzig Jahren aus dem Bewusstsein der Radikalen Linken scheinbar verschwunden ist. Wir wissen, dass die Theorie der Autonomen mehr als dürftig war. Die Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen aber hat die Lebenswirklichkeit der Autonomen umwoben. Die Bank passt mir nicht, dann wird die Bank eben platt gemacht. Das Haus gefällt mir, also besetze ich es. Es geht mir hier nicht um die Glorifizierung von Bankenanzünden oder Freiraumkampagnen, sondern um die Einforderung der Revolution im Jetzt und Hier. Es geht um die empfundene Unerträglichkeit der Zustände, die mit einem Handeln verknüpft bleibt. Kritik, die nie als Erbauung diente, sondern zur Handlung trieb. Nahm die Verknüpfung von Lebenswirklichkeit und Kritik bei den Autonomen eher politische Formen an, hat es die Ungeduld der Punks gar nicht mehr nötig, als „Politik“ wahrgenommen zu werden: Kritik als Praxis muss nicht die Formen von politischen Kampagnen annehmen, sondern beginnt damit, dem Polizisten ins Gesicht zu rotzen oder mit dem Casio durch die sonst so leise Innenstadt zu ziehen. Diese Fuck-Off-Mentalität, das Begehren, den Kampf gegen diese Gesellschaft nicht nur auf einer kritisch-reflektierten Ebene zu führen, sondern gegen jede Einrichtung, die uns diese Gesellschaft anbietet, sei es die Familie, die Arbeit, die Klasse oder das Studium, ist dem trendigen postantideutschen Lifestyle fremd. Man sucht die Kritik stattdessen im Strobo, nimmt sich selbst zurück und verfällt der Lethargie, die den Linksradikalismus seit Jahren umgibt.
Damit man mich nicht missversteht: „Wir wählen immer nur zwischen dem Falschen und dem Versuch, das Falsche nicht zu wiederholen und es wird in den bestehenden Verhältnissen nicht mehr als diesen nie zum Ziel gelangenden Versuch geben.“ Der Moment aber, in dem ich versuche, das Falsche nicht zu wiederholen, weist auf die Möglichkeit hin, mich eines Tages vom Ganzen zu emanzipieren. Er weist auf die Möglichkeit hin – sei sie auch noch so unwahrscheinlich- zu Handeln, einen Bezug zwischen sich und der Geschichte herzustellen. Die Gelegenheiten, in denen wir dennoch immer wieder die zum Scheitern verurteilten Versuche vollziehen, Dinge radikal zu verändern, verknüpfen uns selbst mit dieser Welt. Wenn der Quell der Kritik die Unerträglichkeit des eigenen Lebens ist, so muss sie zur Handlung treiben. Und wenn für eineN so genannteN KritikerIn jedes Handeln zum Scheitern verurteilt ist, dann hat sie/er bereits die politikwissenschaftliche Verkürzung akzeptiert, dass jegliches Handeln Politik sei. Die Lethargie des Kritikers ist die säkularisierte Form des Vita Contemplativa. Das Gegenteil dieser ist die Natalität des Menschen, „der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt“ (Arendt) und das Handeln erst ermöglicht. Die Überzeugung, als Mensch in die Geschichte eingreifen zu können, macht das Handeln zu emanzipatorischen Zwecken erst möglich.
Die Kritik ist kein Lebensgefühl, mit dem es sich gut Leben lässt, sondern die Unzufriedenheit mit dem hier und jetzt, dass dem Bestehenden produktiv zu schaden gedenkt. Für wen die Kritik nur aus akademischem Jargon und Lifestylehedonismus besteht, die/der hat den Bezug zur kommenden Revolte längst verloren. Die/der nimmt die Aufstände nicht einmal mehr wahr, die sich in den Banlieues von Paris oder auf den Straßen von Teheran abspielen. Statt die Unmöglichkeit der kommunistischen Revolution anzunehmen, stelle ich mich lieber ganz in die sich weiter vollziehende Geschichte und betrachte die stattfindenden Revolten auch als die meinen. Was, außer die unantastbare Überzeugung, dass diese Gesellschaft überwunden werden kann, sollte sonst mein Antrieb sein, Kritik zu betreiben?
Von Benjamin Böhm