Die kommenden Revolten. Teil IV (1)
Für einen, den ich nicht vergessen will
1.
Die Welt, in der wir heute leben, wird nicht mehr untergehen. Denn wir leben bereits nach dem Ende der Welt. Die Katastrofe, vor der doch alle sich fürchten müssen, braucht nicht eigens mehr eintreten; dass immer noch alles so weitergeht, nach allem, das ist bereits die Katastrofe.
Die früheste kommunistische Kritik des Kapitals knüpfte an den Aufweis, dass das Kapital unter dem Gesetz der Krise stehe, die Hoffung auf dessen mögliche Abschaffung; das Kapital stellte, mit Weltmarkt und Proletariat und der Ausdehnung der Produktivkräfte, die Grundlagen seiner Aufhebung her, der allgemeinen Befreiung; und seine inneren Widersprüche, die sich in der Krise gewaltsam geltend machten und sich im Laufe der Entwicklung ständig verschärfen mussten, machten seinen Untergang notwendig.
Aus der doppelten Notwendigkeit, der der Kämpfe der Klassen, und der der Zusammbruchskrise, ergab sich die Verheissung einer Weltrevolution, in der das Proletariat als befreiende Klasse die Grundlagen der Ordnung, Staat und Familie und Kapital, abschaffen und die Errungenschaften ihrer Zivilisation, auf ihrem höchsten Niveau, zugleich als Grundlage für eine endlich befreite Menschheit retten würde. Diese Verheissung ist nicht eingetroffen, aber nicht, weil sie falsch gewesen wäre, sondern weil die Revolutionäre nicht gesiegt haben.
Denn die Weltkrise ist wirklich gekommen, und auch der Weltkrieg und der Anfang der Revolution, die ihn endlich beendet hat, aber als der Kapitalismus 1929 tatsächlich in seine finale Krise gekommen war, versagte die Revolution. Im Nationalsozialismus gelangte die Gesellschaft des Kapitals schliesslich zum Punkt ihrer völligen Entfaltung: als antisemitische Volksgemeinschaft, der die Krise wie die Widersprüche vollends ausgetrieben sind, weil sie das Geschäft der Krise gleich selbst betreibt, fugenlos mit sich selbst identisch und mit nichts als Vernichtung im Sinn.
Damit endet eigentlich die Geschichte von Krise und Revolution, der Nachweis ist erbracht, dass die Gesellschaft des Kapitals keineswegs die Bedingungen des Kommunismus produziert. Mit dem Klassenkampf, sogar mit der Zusammenbruchskrise sind die Deutschen fertig geworden, so sehr haben sie die Herrschaft geliebt. In dem Masse, in dem der deutsche Nationalsozialismus sich globalisiert, von anderen Gesellschaften zum Modell genommen wird, kann die bisherige Geschichte nicht mehr als Vorgeschichte einer befreiten Menschheit angesehen werden, sondern als die der nunmehr verewigten Katastrofe.
2.
Der Revolutionsversuch von 1968 geschah schon in einer Zeit, die zur Wiederkehr des Gleichen verurteilt schien, völlig präzedenzlos und ohne jede Erklärung, die sich aus den objektiven Tendenzen ableiten liess. Ein Aufstand gegen die Geschichte, fast ein Mirakel. Die Bewegungsgesetze des Kapitals lassen zwar keinen Zweifel, dass das Verhängnis der Krise auch für die nachfaschistischen Gesellschaften gelten muss; die Revolte von 1968, allen Erklärungsversuchen einer Linken zum Trotz, die selbst nichts verstanden hat, war aber keine Reaktion auf eine ökonomische Krise.
Die ökonomische Krise kam im Gegenteil nach der Revolte, und zwar die längste und tiefste Krise in der Geschichte der kapitalistischen Ökonomie. Sie hat bis heute nicht geendet. Dass sie mehr als dreissig Jahre dauert, dass sie überhaupt eine Krise ist, ist nicht mehr allgemein bekannt, dermassen ist sie Normalität geworden. Wir leben in ihr. Alle ökonomischen Erklärungen sind an ihr zuschanden geworden: die immer heftigeren Ausschläge der Konjunkturen in immer kürzeren Zyklen, die von Zyklus zu Zyklus beschleunigte Freisetzung von Arbeitskräften, die immer intensivere Vernutzung der Arbeitskraft bei gleichzeitiger Massenarbeitslosigkeit, ungeheuerste Akkumulation, dabei Verelendung ganzer Weltgegenden; über allem aber ein katastrofales Sinken der Wachstumsraten über die Zyklen hinweg.
Unter denen, die nicht Ökonomie betreiben wollen, sondern deren Kritik, gibt es zwei Richtungen. Die eine Schule, nennen wir sie die objektive, greift zurück auf den dritten Band des Kapital; dort finden z.B. Bischoff, Huffschmidt und Kurz die Erklärung, dass mit steigender Kapitalszusammensetzung, d.h. fortschreitender Ersetzung von menschlicher Arbeitskraft durch Maschine, die Profitrate sinken muss, und ziehen daraus den Schluss, dass beim heutigen Stand der Produktivkräfte reale Produktion weniger profitabel sein müsse als die sogenannte Spekulation auf den sogenannten Finanzmärkten. Anlagesuchendes Kapital und unbeschäftigte Arbeitskraft ständen sich gegenüber, ihr Austausch lohnte aber für das Kapital immer weniger. Die unterschiedliche Pointe besteht nun darin, dass Bischoff und Huffschmidt das Dilemma durch Dazwischengreifen des Staates lösen wollen, während Kurz den Zusammbruch der kapitalistischen Produktionsweise sehen will.
Die andere Schule, die operaistische, beschreibt die Massenerwerbslosigkeit als Ergebnis der radikalen Fabrikkämpfe der 1960er und 1970er. Die Herrschaft in den Fabriken, und damit die gesamte Verfassung der kapitalistischen Reichtumsproduktion, war nur durch tiefgreifende Disziplinierung der Arbeitschaft, durch Umstrukturierung der Produktion aufrechtzuerhalten; durch massenhafte Freisetzung von Arbeitskraft, durch eine neue Welle der Automation, durch Auslagerung von Produktionsschritten, in der Konsequenz durch die Politik der Austerität, und das heisst durch die Krise. Die Operaisten beschreiben im einzelnen, und durchaus umständlich, wie die kapitalistische Umstrukturierung durch Arbeiterwiderstand erzwungen wurde; Widerstand, der (übrigens entgegen der Intentionen dieser Schule) verblüffend wenig ökonomisch motiviert war, sondern fast anti-ökonomisch, weniger als Kampf um mehr Lohn denn als Kampf gegen Lohnarbeit.
Die objektive Schule hat dagegen zwar genau den ökonomischen Zusammenhang zwischen der kapitalistischen Umstrukturierung und der Krise der Weltökonomie analysiert, ohne sich jedoch die Frage zu stellen, was die Umstrukurierung erzwungen hat. Wo die objektive Schule (und man lese meinetwegen das bei Bischoff nach) seit ehedem dieselben Sätze aus dem dritten Band zitiert, und seit ehedem ihre Tatsachen danach biegt, dass sie darunter passen, kann man (man lese es bei Moroni/Balestrini oder bei Wright) die operaistische Schule dabei beobachten, wie ihr ihr eigener Leninismus, zu ihrer eigenen Überraschung, im selben Masse in Stücke bricht, in dem sich die Disziplin der Fabrik auflöst; wie sich aus dem historischen Geschehen, statt des erhofften Aufbaus einer neuen bolshevikischen Partei, unter ihren Händen nichts herausschält als eine Tendenz im Proletariat, dass es einfach genug ist und dass es nicht mehr geht. Die Angelegenheit endigt vorläufig mit der 1977er Bewegung, die im Keim alle unsere gegenwärtige Realität enthält.
Es blieb den Operaisten nicht erspart, das, was sie daran kaum verstanden, sofort zu einer neuen revolutionären Subjektivität zu erklären. Man lese beim Verrückten Negri nach, zu welchen Exzessen gar ein Nietzscheaner in dem Zusammenhang fähig ist. Sie haben aber Zeugnis abgelegt von einer Wirklichkeit, die von der objektiven Schule gar nicht erst zur Kenntnis genommen worden ist. Uns heute sind sie allein deshalb unschätzbar, weil sie den Gedanken haben denkbar werden lassen, es könne die Krise, und zwar diesmal die wirklich finale des Kapitals, durch autonomes Handeln des Proletariats provoziert werden, und nur dadurch.
3.
Die Ordnung hat gesiegt, aber zu recht wollen ihre paranoiden Verwalter davon nichts wissen. Der Preis für den Sieg war die unabsehbare Fortdauer der Krise. Gelöst, also entschieden, ist sie nicht; und das ist einigermassen erstaunlich. Im Gegenteil war die Krise immer gegenwärtig, schon vor ihrer heutigen Zuspitzung.
Heute brechen amerikanische Banken zusammen, weil die amerikanischen Mittelklassen sich ruiniert haben; deren Bereitschaft, ihren Konsum durch Kredite zu finanzieren, war aber der treibende Motor der Weltökonomie. Einen anderen gibt es seit mindestens 15 Jahren nicht mehr: das ist die Wahrheit der Krise. Was diese Ökonomie an Waren ausstösst, ist mit dem, was sie als Löhne ausstösst, nicht zu bezahlen. Die tugendhafte Entrüstung der scheinheiligen Deutschen und anderen Gesindels über derart spekulatives Treiben müsste man eigentlich nicht kommentieren, sie entlarvt sich als geschäftstüchtige Niedertracht derer, die 15 Jahre an den Amerikanern gut verdient haben.
Die Deutschen aber sind leider gefährliche Irre, und man muss nur die Kommentare aus allen Teilen ihrer Eliten über die amerikanischen Versuche hören, die Banken zu retten: da reitet welche die Lust am Untergang; man muss einmal mit Entsetzen feststellen, wie jenseits aller vier Grundrechenarten die Elite und das Volk genau das gleiche denken, das gleiche sagen5: sie wären bereit, geschlossen in die Katastrofe zu ziehen, nicht weil sie 1929 vergessen hätten, oh im Gegenteil. Die deutsche Elite jedenfalls rüstet sich auf den Tag, an dem die amerikanische Ordnung zusammenbricht; es lohnt sich, hierzulande, sich das gesagt sein zu lassen. Dass die Krise von den Amerikanern käme: das wird ihnen hier jeder glauben, und was dann zu tun ist, weiss ein Deutscher, wenn er auch sonst nichts weiss.
Nicht die Finanzmärkte haben aber die Krise gemacht, nicht die Amerikaner, nicht der Neoliberalismus, sondern das Proletariat, das heisst wir haben sie gemacht, wenn auch nicht aus freien Stücken; in ihr drückt sich nichts aus als die Unmöglichkeit, dass die Menschheit in dieser Gesellschaftsordnung weiter existiert. Die Revolte von 1968, und sie ist die Flamme, von der wir erloschenen heute allesamt kommen, hat die Krise gemacht, sie hat die kapitalistische Moderne zertrümmert, nach ihr ist die Menschheit nie wieder regierbar geworden, und selbst die konterrevolutionäre Ordnung muss die Form eines unaufhörlichen Gegenangriffs annehmen. Die Krise ist unsere Krise, und wir können es nicht begreifen, weil wir unsere eigenen Krisen für ein privates Unglück halten müssen statt für ein gesellschaftliches Verhängnis; und die Gewalt, die wir uns antun müssen, um weiter zu funktionieren, ist dieselbe Gewalt, die uns angetan wird, damit die Maschine weiter funktioniert.
Die Krise ist die Wiederkehr des Verdrängten, in ihr kehrt, was der Menschheit an Insubordination ausgetrieben wurde, als blindes ökonomisches Verhängnis wieder. Die Menschheit ist aber heute weit davon entfernt, die Unmöglichkeit des Fortbestehens dieser Ordnung bewusst zu produzieren und aus freien Stücken statt unter Zwang.
Deswegen werden, wenn es zum Zusammbruch der Weltmärkte kommt, die Deutschen wieder hinter ihren Eliten marschieren, die aus 1933 gelernt zu haben scheinen, dass sie sich vor der Konkurrenz der Faschisten nicht fürchten müssen, wenn sie den Faschismus gleich selbst organisieren. Die Welt ist aber nach wie vor so eingerichtet, dass nicht auszuschliessen ist, das Auschwitz sich wiederhole oder ähnliches geschehe. (2)
Untergehen wird diese infame Welt davon freilich sowenig, wie sie beim letztenmal davon untergegangen ist; sie ist ja bereits selbst die Katastrofe, und erst die Rettung wäre ihr Untergang. Ob aber der Menschheit der unwahrscheinliche Griff nach der Rettung, über den Rand des Abgrunds zurück, doch noch gelingt, ob sie sich überhaupt noch vor sich selbst Entsetzen kann, weiss ich nicht. Verdammte sind wir bereits, zu einem Leben nach dem Weltende; wenn unser eigenes Entsetzen nicht ausreicht, um Konsequenzen zu ziehen, haben wir der Menschheit schon nichts mehr mitzuteilen.
Von Jörg Finkenberger
Man kann folgendes gerne lesen:
Primo Moroni / Nanni Balestrini: L’orda d’oro (Dt.: Die Goldene Horde. Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien. Verlag Assoziation A): Sehr lesenswert.
Steve Wright: Storming Heaven (Dt.: Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus. Verlag Assoziation A.): Achtung, schlecht. Trotzdem vll lesen.
Rene Vienet: Wütende und Situationisten in der Bewegung der Besetzungen, 1968. Bestellen bei klassenlos.tk oder Englisch unter cddc.vt.edu/sionline/si/enrages.html
Sergio Bologna: La tribu delle talpe (Engl.: The Tribe of Moles, etwa: Der Stamm der Maulwürfe), 1977, über die 1977er Bewegung, unter geocities.com/cordobakaf/moles.html
Wolfgang Pohrt: Über Vernunft und Geschichte bei Marx, 1978. Unter trend.infopartisan.net/trd0502/t300502.html.
Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte, 1940. Unter mxks.de/files/phil/Benjamin.GeschichtsThesen.html
(1) Der folgende Text gibt einen Vortrag des Verfassers wieder, der im Sommer 2008 am Mainufer vor einem sixpack und einer Zuhörerin gehalten wurde. Der Verfasser dankt der Zuhörerin für ihre Geduld.
(2) Nicht ganz. Noch gibt es Israel. Solange Israel steht, ist die Katastrofe nicht ganz vollständig. Wenn Israel fällt, gehören wir alle dem Teufel. So einfach kann das sein mit der Solidarität mit Israel.
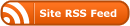
Sehr guter Text, die Reihe bitte fortsetzen. ¡Adelante!
Moin
ALso der Begriff Revolution ist zumindest auf die deutschen 68er nicht wirklich anzuwenden. Über die italienischen Arbeiter könnte man das wohl eher sagen.
Mir gefällt der Text, aber dieses „f“ in Katastrofe ist eine in sich, nix für ungut
Gut argumentiert „oje…“
Selten so was dämliches gelesen. Allein: „Der Revolutionsversuch von 1968…“ Und die Ausführungen zur US-Wirtschaft: Beeindruckend vielleicht für Grundschüler.
Merke: Unleserliches Geschreibe macht aus einfältigen bis dummen Gedankengängen keinen anspruchsvollen Text. Das Ergebnis bleibt lächerlich.
Lies noch ein paar mehr Bücher, dann wird vielleicht noch mal was aus dir. Wobei ich diesbezüglich pessimistisch bin.