(hier wird ein Artikel aus dem letzten Hype Nr. 14 nachgereicht:)
Wenn sie nur noch tanzen können, ist das keine Revolution1
Von antideutschen Fanmeilen und dem Verlust der radikalen Lebenswirklichkeit
Raven gegen Deutschland. Hunderte zuckende Leiber scheinen den Text zu kennen, wippen im Takt, fühlen sich synthiewohl. Raven gegen Deutschland, an einem Ort namens Posthalle. Es ist interessant, wie sich die Zeiten ändern: Hätte man vor fünf Jahren ein Projekt wie Egotronic in das Autonome Kulturzentrum holen wollen, gewisse Leute wären in schallendes Gelächter ausgebrochen. Zu wenig Publikum, zu linksradikal, zu antideutsch, whatever. Heute veranstalten die selben Menschen, die damals das AKW zugrunde gerichtet haben, in ihrer Posthalle ein Festival mit- wie sollte es anders sein- Egotronic, samt ihrer FreundInnen vom Label Audiolith. Es scheint etwas passiert zu sein, das ich nicht ganz nachvollziehen kann: Linksradikales Parolenrufen wurde in den letzten Jahren zum Chique geadelt, hat die Autonomen Zentren verlassen und findet jetzt selbst an einem gottverlassenen Ort wie Würzburg statt, inklusive hunderter Kids, die die Texte in- und auswendig lallen können.
Be cool- be antideutsch. Es gibt keinen abgedroscheneren Werbespruch, der mir gerade in den Sinn kommt, um die seichte Elektrowelle zu beschreiben, die von Flensburg bis Fürstenfeldbruck Jugendliche in ihren Bann zieht. Niemand kann ernsthaft behaupten, dass es sich bei diesem Phänomen um die Speerspitze einer neuen kritischen Bewegung handelt. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Wer tanzende Elektrokids beim Audiolith-Festival beobachtet, fühlt sich eher an das Grauen der deutschen Fanmeilen zurück erinnert. Und plötzlich schließt es sich nicht mehr aus, dass jemand „Raven gegen Deutschland“ ruft und in ein paar Monaten „Steht auf, wenn ihr Deutsche seid!“2. Es besteht ein Zusammenhang zwischen einfach zugänglicher Elektromusik und einfach zugänglichem, alles nach plapperndem Publikum3. Würden Egotronic ihre bisherigen Texte durch die Zeilen von Alexander Marcus ersetzen, so würden sich wahrscheinlich nur die Oldschoolfans darüber ärgern. Und man kann noch so viele Versuche unternehmen, das Saufen und PEP-durch-die-Nase-Ziehen mit politischem Gehalt aufzuladen, es bleibt nichts anderes als Saufen und PEP-durch-die-Nase-Ziehen, Wirklichkeitsflucht und Enthemmung eben, wie sie größtenteils auch vom Rest der Bevölkerung dann und wann betrieben wird.
In dem Moment, als aus einer radikalen Richtung ein popkultureller Lifestyle wurde, hat auch das Label „Antideutsch“ voll und ganz seine Bedeutung verloren10. Popkultureller Lifestyle bedeutet nämlich: Man hat sich eingerichtet. Man bewegt sich unbeschwert in den Formen der Kulturindustrie, als ob die bürgerliche Gesellschaft eine Klaviatur sei, auf der man locker-leicht das Lied der Emanzipation klimpern könne. Man betreibt ein linksradikales Zine wie das Hate-Magazin, in dem sich gelangweilte GrafikdesignerInnen austoben dürfen, gibt eine ach so kreative Schülerzeitung wie „Straßen aus Zucker“ heraus 4und rezipiert ein wenig Adorno zur Steigerung der sexuellen Attraktivität. Nichts anderes ist dieser Lifestyle aber als die Flucht in eine wohlige Nische, in der es sich gut Leben lässt. Die Revolution kommt später oder nie, zuerst kommt das Projekt. Und egal wie viele Drogen man am Wochenende konsumiert hat, am Montag ist die Arbeitskraft wieder hergestellt, damit man in die Uni gehen kann, in der Uni lehren kann, in der Schule sitzen kann, im Betrieb schwitzen kann, in der Werbeagentur kreativ sein kann.
Ich weiß nicht, wie oft ich von Kids „es gibt kein richtiges Leben im falschen“ gehört habe. Was wollen sie eigentlich damit legitimieren? Ist es das jämmerliche Leben, dass auch ihre 68er-Eltern führten und das auch sie führen werden? Der Gang durch die Institutionen, diesmal aber nicht mit der naiven Vorstellung, dass man diese von Innen heraus verändern könne, sondern mit der Überzeugung, dass es kein Vita Activa gibt, sondern nur die Einsamkeit der/der KritikerIn? Was die jungen AnhängerInnen des neuen postantideutschen Hedonismus5 eint ist die feste Überzeugung, dass die Revolution auf später verschoben werden muss und das emanzipatorische Begehren solange im Lustprinzip aufbewahrt werden muss, bis diese Gesellschaft in ein paar Jahrzehnten, in ein paar Jahrhunderten oder nie an ihren Widersprüchen zerberstet. Mir kommt es so vor, als müsse man sich an nichts mehr in ihrem/seinen Umfeld stoßen, weil ja kein richtiges Leben im Falschen gibt. Es ist die postantideutsche Lifestyleszene, die die Dialektik der Aufklärung nicht als Handbuch der Revolution gebrauchen kann, sondern zur persönlichen Erbauung nutzt.
Sie mögen damit glücklich werden, Kiddies die noch zur Schule gehen und bereits jetzt zu wissen scheinen, dass sie den Kommunismus nicht mehr erleben werden, einen postantideutschen Elektrolifestyle leben und ansonsten die Versuche, das Falsche im Falschen zu verhindern, verlachen. Schade ist es um sie nicht. Was linksradikal sozialisierten Kids abhanden kam ist die Ungeduld des revolutionären Begehrens6, eine radikale Lebenswirklichkeit, die sich an seinem/ihrem Umfeld und den Lebensformen, die die bürgerliche Gesellschaft anbietet, stößt, anstatt sie als notwendiges Übel anzuerkennen. Dabei ist die Frage zu stellen nach dem Ausgangspunkt der Kritik. Wozu betreiben wir Kritik? Zur Selbstvergewisserung, dass man die Gesellschaft verstanden habe, während die anderen Menschen auf der Linken Seite noch immer im Trüben fischten? Radikale Kritik, die mehr ist als das Jargon der akademischen Seminare, hat bei sich selbst und bei ihrer/seiner eigenen Lebenswirklichkeit anzufangen. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang von Lebenswirklichkeit und Kritik. Kritik taugt zu nichts, wenn hinter ihr nicht das Begehren steckt, das eigene geknechtete, unwürdige Leben hinter sich zu lassen. Die Einforderung des schönen Lebens, und zwar jetzt und sofort, ist eine notwendige Bedingung jeder Kritik, die in den letzten zwanzig Jahren aus dem Bewusstsein der Radikalen Linken scheinbar verschwunden ist. Wir wissen, dass die Theorie der Autonomen mehr als dürftig war. Die Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen aber hat die Lebenswirklichkeit der Autonomen umwoben. Die Bank passt mir nicht, dann wird die Bank eben platt gemacht. Das Haus gefällt mir, also besetze ich es. Es geht mir hier nicht um die Glorifizierung von Bankenanzünden oder Freiraumkampagnen, sondern um die Einforderung der Revolution im Jetzt und Hier. Es geht um die empfundene Unerträglichkeit der Zustände, die mit einem Handeln verknüpft bleibt. Kritik, die nie als Erbauung diente, sondern zur Handlung trieb. Nahm die Verknüpfung von Lebenswirklichkeit und Kritik bei den Autonomen eher politische Formen an, hat es die Ungeduld der Punks gar nicht mehr nötig, als „Politik“ wahrgenommen zu werden: Kritik als Praxis muss nicht die Formen von politischen Kampagnen annehmen, sondern beginnt damit, dem Polizisten ins Gesicht zu rotzen oder mit dem Casio durch die sonst so leise Innenstadt zu ziehen. Diese Fuck-Off-Mentalität, das Begehren, den Kampf gegen diese Gesellschaft nicht nur auf einer kritisch-reflektierten Ebene zu führen, sondern gegen jede Einrichtung, die uns diese Gesellschaft anbietet, sei es die Familie, die Arbeit, die Klasse oder das Studium, ist dem trendigen postantideutschen Lifestyle fremd. Man sucht die Kritik stattdessen im Strobo, nimmt sich selbst zurück und verfällt der Lethargie, die den Linksradikalismus seit Jahren umgibt7.
Damit man mich nicht missversteht: „Wir wählen immer nur zwischen dem Falschen und dem Versuch, das Falsche nicht zu wiederholen und es wird in den bestehenden Verhältnissen nicht mehr als diesen nie zum Ziel gelangenden Versuch geben.“ Der Moment aber, in dem ich versuche, das Falsche nicht zu wiederholen, weist auf die Möglichkeit hin, mich eines Tages vom Ganzen zu emanzipieren. Er weist auf die Möglichkeit hin – sei sie auch noch so unwahrscheinlich- zu Handeln, einen Bezug zwischen sich und der Geschichte herzustellen. Die Gelegenheiten, in denen wir dennoch immer wieder die zum Scheitern verurteilten Versuche vollziehen, Dinge radikal zu verändern, verknüpfen uns selbst mit dieser Welt. Wenn der Quell der Kritik die Unerträglichkeit des eigenen Lebens ist, so muss sie zur Handlung treiben. Und wenn für eineN so genannteN KritikerIn jedes Handeln zum Scheitern verurteilt ist, dann hat sie/er bereits die politikwissenschaftliche Verkürzung akzeptiert, dass jegliches Handeln Politik sei. Die Lethargie des Kritikers ist die säkularisierte Form des Vita Contemplativa. Das Gegenteil dieser ist die Natalität des Menschen, „der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt“ (Arendt) und das Handeln erst ermöglicht. Die Überzeugung, als Mensch in die Geschichte eingreifen zu können, macht das Handeln zu emanzipatorischen Zwecken erst möglich.
Die Kritik ist kein Lebensgefühl, mit dem es sich gut Leben lässt, sondern die Unzufriedenheit mit dem hier und jetzt, dass dem Bestehenden produktiv zu schaden gedenkt. Für wen die Kritik nur aus akademischem Jargon und Lifestylehedonismus besteht, die/der hat den Bezug zur kommenden Revolte längst verloren. Die/der nimmt die Aufstände nicht einmal mehr wahr, die sich in den Banlieues von Paris oder auf den Straßen von Teheran abspielen. Statt die Unmöglichkeit der kommunistischen Revolution anzunehmen, stelle ich mich lieber ganz in die sich weiter vollziehende Geschichte und betrachte die stattfindenden Revolten auch als die meinen. Was, außer die unantastbare Überzeugung, dass diese Gesellschaft überwunden werden kann, sollte sonst mein Antrieb sein, Kritik zu betreiben?
Von Benjamin Böhm
- Dieser Text könnte auch Antideutsch für Deppen Teil 2 heißen. Die Drohungen und Schmäh-SMS, die mir nach meinem Antideutsch-für-Deppen Teil 1 vor mittlerweile fast drei Jahren geschickt wurden, habe ich als Erinnerung an den bayerischen Antifa-Kindergarten noch in meinem Handy gespeichert und kann immer noch herzhaft über sie lachen. Ich frage mich manchmal, was aus ihnen geworden ist, den Bauchantideutschen aus Ober- oder Unterammergau.[zurück]
- Danke an meine Mitmieter in der Zellerau! Diese haben mir zur EM abwechselnd durch Egotronic und „Schlaaaaand“-Rufe den Schlaf geraubt und mir erst verdeutlicht, dass beides zusammen möglich ist. [zurück]
- Kann man es der jugendlichen Fanbase wirklich verübeln, wenn sie die feinen musikalischen und textlichen Unterschiede zwischen den Partyatzen, der Musik für junge Leute mit Vergewaltigungsphantasien, und Frittenbude, nicht erkennen kann? [zurück]
- Ich habe schon interessantere Schülerzeitungen gelesen. Der emanzipatorische Gehalt eines Interviews mit KIZ bleibt mir bis heute unbekannt. [zurück]
- Es gilt hier zu betonen, dass dieser Text nicht dazu verwenden werden soll, im Namen von Internet-Antiimps als Kronzeuge gegen die Antideutschen zu fungieren. Die Antideutschen sind tot, und erbärmlich die geistigen Ausdünstungen der meisten ihrer einstigen RepräsentantInnen. Die antideutsche Kritik hat jedoch keinesfalls ihre Berechtigung verloren. Im Rahmen von linken Zusammenhängen lässt es sich aber wohl schwer vermeiden, dass ein Text wie dieser als Anklage gegen die Antideutschen verwendet wird, genauso wie Robert Kurz auch heute noch von den dümmsten unter den AntiimperialistInnen rezipiert wird. [zurück]
- Dieser Absatz macht eigentlich zwei Fässer auf, die nur bedingt miteinander in Verbindung stehen. Zum einen wird hier das kontemplative Element der antideutschen Kritik angesprochen. Zum anderen aber auch die Lebensflucht und Todesehnsucht, die hinter dem Selbstbild deren stehen, die man als postantideutsche RevolutionsverfechterInnen bezeichnen könnte. Justus Wertmüller hat darüber vor wenigen Monaten einen ganz lesbaren Text geschrieben. Es wird im Hype #15, noch einmal darauf zurückzukommen sein. [zurück]
- Gegen diese Ungeduld richtete sich bereits Lenin, als er den Linksradikalismus als Kinderkrankheit bezeichnete. Ich halte mich da lieber an den Genossen Herman Gorter. [zurück]
- Dieser Text wäre ohne die Gspräche mit Asok und Phil_Ill nicht möglich gewesen. Ich hoffe, ihr findet unsere damaligen geteilten Ansichten ein wenig in diesem Text wieder… [zurück]
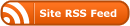
ich hab vor einigen semestern gewechselt, also darf ich!
nun, fehlen mir, glaub ich, die richtigen worte, um mich für diesen artikel zu badanken. andrerseits weiß ich gar nicht, ob mensch sich für so was überhaupt bedankt. also lass ich das wohl.
nur noch eine anmerkung meinerseits – ohrfeigen tut mensch wohl nicht wannebe-ad-kids aus kitzingen, miltenberg oder whatever. ohrfeigen tut mensch sich selbt, weil mehr sinn macht.
in diesem sinne: für mehr koks, israel und kommunismus überall!
nur wenn du noch ein nebenfach wechselst und in einem jahr dann wieder im zweiten semester bist.
mist eigtl. wollte ich mal wieder einen bericht für euch schreiben. aber ich bin im 12 provinzsemester. darf ich trotzdem noch mitmachen?
In der Tat!
„bei einem solchen thema“, in der tat! da muss man sich in der tat nicht wundern.
und schon gar von provinzzweitsemestern!grossartig.
weitermachen, weitermachen!
Auf den Schlips treten war doch die Intention dieses Textes. Dass bei einem solchen Thema, geschrieben von ein paar Provinzzweitsemestern, welche offensichtlich einen starken Distinktionsdrang verspüren, und der bei planet.blogsport.de auftaucht, ein paar Rektionen kommen, ist nun auch nicht sonderlich überraschend, als dass es hier von den Claqueuren des Provinzabgrenzungsblättchens ständig wieder thematisiert werden würde, um sich dann über den reichlich beknackten Umkehrschluss „Mönsch, da fühlen sich ja einige auf den Schlips getreten“! zu freuen.
da scheint ja jemand einer ganzen szene (zurecht) ganz schön auf den schlips getreten zu sein.
die hysterie mit der auf den text reagiert wird sagt eigentlich schon alles.
dazu auch interessant:
„Und man kann noch so viele Versuche unternehmen, das Saufen und PEP-durch-die-Nase-Ziehen mit politischem Gehalt aufzuladen, es bleibt nichts anderes als Saufen und PEP-durch-die-Nase-Ziehen..“
Richtig, deswegen macht es auch wenig Sinn daraus einen Vorwurf zu machen.
Damit ist doch der ganze Text überflüssig?
„Man sucht die Kritik stattdessen im Strobo, nimmt sich selbst zurück und verfällt der Lethargie, die den Linksradikalismus seit Jahren umgibt“
Das machen weniger die Egotronicfans, als vielmehr du selbst.
Du bist derjenige, der einen Text über eine per se unpolitische Tätigkeit schreibt, nämliche Tanzen und feiern und dort einen kritischen Gehalt finden will.
Dor wo keiner ist und auch keiner sein will bzw. überhaupt sein kann.
du übrigens auch nicht.
du bist nicht witzig.
Der Autor lässt verlauten, dass er seine „erbärmliche Sinnkrise“ mit Hilfe von Erkältungsbädern, experimentellem Kochen und der Lektüre von Vaneigems „Handbuch der Lebenskunst“ überwunden hat.
@ Rainer Bakonyi:
„etwas kryptisch, das ‚damit’. Ich interpretiere es als die Vermutung, daß der Kollege Böhm eine ungenügende Reflektion der Bedingungen des ‚Handelns’ (id est: jede Unternehmung, welche zur Abschaffung der Herrschaft von Menschen über Menschen führen könne) vorgenommen habe.“
Naja. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welches „damit“ Du dich beziehst. Wenn Du das, aus dem Satz meinst: „Wenn ich damit recht hätte …, dann sollte es sich auf den größten Teil des weiter oben geschriebenen Kommentars beziehen, indem es mir genau um das ging, was ich als Frage nach den Bedingungen des „Handelns“ bezeichnet habe; „Handeln“ in dem Sinne, in dem es Böhm in seinem Text verwendet. (Soviel auch zum „hä?“ von Oma Erna).
Wenn ich diesen Text richtig verstehe, dann gibt er drei Beispiele für das „Handeln“, das er im Sinn hat: Das der Autonomen, zu dem er aber dann doch – aus genannten guten Gründen – eine gewisse Distanz wahren möchte. Aus „Fuck-off-Mentalität“, „dem Polizisten ins Gesicht zu rotzen oder mit dem Casio durch die sonst so leise Innenstadt zu ziehen“, und, letztlich die Aufstände von Paris über Griechenland bis in den Iran.
Lässt man letzteres zunächst einmal beiseite, dann geht es also nicht (nur) um Handlungen, die man unmittelbar als „Unternehmung(en) welche zur Abschaffung der Herrschaft führen könnte(n)“ bezeichnen kann, sondern um solche, die, das „Begehren, den Kampf gegen diese Gesellschaft nicht nur auf einer kritisch-reflektierten Ebene zu führen, sondern gegen jede Einrichtung, die uns diese Gesellschaft anbietet, sei es die Familie, die Arbeit, die Klasse oder das Studium“ ausdrücken sollen.
„Handlungen“ zweitgenannter Art meinte ich mit „Akt bloßer Selbstverteidigung … (wogegen nichts einzuwenden ist)“ – In einer Zeit, in der sich zunehmend eine Schwungmasse militanter Nicht-raucher, Anti-alkoholiker, Lärmschutzwächter und vergleichbaren Gesindels formiert, finde ich die Bezeichnung der „Selbstverteidigung“ übrigens sehr angemessen und kein bisschen übertrieben – Soweit bin ich mit dem Text völlig einverstanden.
Böhm schreibt dann: „Wenn der Quell der Kritik die Unerträglichkeit des eigenen Lebens ist, so muss sie zur Handlung treiben.“ Offensichtlich ist, dass es hier um mehr und anderes geht, als vorher: Sich selbst als Individuum zu begreifen, dem es möglich ist, in die Geschichte zu interrvenieren; weiter, aus der Unerträglichkeit des eigenen Lebens die Konsequenz zu ziehen, dass jetzt und hier ein anderes, besseres Leben her muss. Für Hype-Leser dürfte das gewiss banal sein, und es ist hoffentlich unnötig anzufügen, dass ich auch das uneingeschränkt teile. Er schreibt weiter: „Und wenn für eineN so genannteN KritikerIn jedes Handeln zum Scheitern verurteilt ist, dann hat sie/er bereits die politikwissenschaftliche Verkürzung akzeptiert, dass jegliches Handeln Politik sei.“ Wenn ich den Text richtig verstehe, steht das in Zusammenhang mit dem Satz: „Statt die Unmöglichkeit der kommunistischen Revolution anzunehmen, stelle ich mich lieber ganz in die sich weiter vollziehende Geschichte und betrachte die stattfindenden Revolten auch als die meinen.“
Und genau an dieser Stelle wollte ich mit dem aufgeworfenen Frage nach den „Bedingungen des Handelns“ einsetzen: Alleine schon deswegen, weil der Feind über die besseren Waffen verfügt, ist die Revolution nur möglich, wenn sie aus Einsicht – auch der allergrößten Mehrheit des Feindes – geschieht. (Gewiss ein ärgerlicher Umstand, aber ich sehe nicht, wie eine Revolte sonst anders enden könnte, als im Blutbad.) Daraus folgt: Eine Handlung, die weder zum Scheitern verurteilt, noch Politik sein soll, wäre eine solche, die diese Einsicht provoziert. Dann müsste aber sehr wohl darauf reflektiert werden, ob die Bedingungen dafür überhaupt gegeben sind. Akzeptiert man die Bewusstlosigkeit der Disko-gänger als empirischen pars pro toto Befund für den Zustand dieser Gesellschaft – und da kann man mir meinetwegen „Kulturpessimismus“ anhängen – muss ich gestehen, dass meine Hoffnungen da nicht sonderlich rosig aussehen.
Wenn die Revolte zur Revolution werden soll, wird sie auch mehr sein müssen, als die (gewiss notwendige) Zerstörung des Bestehenden; sie wird der Aufbau des ganz Anderen werden müssen. Sicher, es lässt sich nicht theoretisch prognostizieren, was dazu notwendig wäre, sondern nur praktisch verwirklichen. Und trotzdem wäre „eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was als Voraussetzung der Möglichkeit überhaupt zu erst zu denken … bitter nötig“[kann es sein, dass in diesem Satz ein zweites, entscheidendes „nicht“ fehlt? ]; sofern Denken etwas anderes meint, als bloß instrumentelles Denken oder gar Ressentiment; die Möglichkeit nämlich, das ganz Andere zu antizipieren.
Will man nicht zum Bewegungstheoretiker werden, wären die „stattfindenden Revolten“ der genau passende Anlass, darüber zu diskutieren; der „letzte Hype“ und sein Umfeld, eben weil er einer der wenigen Versuche ist, diese Möglichkeiten „auszuloten“, ein richtiger Ort für eine solche Diskussion.
antideutscher wirst du nur, wenn der wütende mob dich dazu macht. muhaha.
@leo: etwas kryptisch, das „damit“. Ich interpretiere es als die Vermutung, daß der Kollege Böhm eine ungenügende Reflektion der Bedingungen des „Handelns“ (id est: jede Unternehmung, welche zur Abschaffung der Herrschaft von Menschen über Menschen führen könne) vorgenommen habe. Das mag evtl. so sein. Der hype als Produkt zwar recht unverbundener, so doch mit gewisser Berechtigung gemeinsam publizierender Wahnsinniger ist auch losgelöst von Bennis individuellem Willen zur revolutionären Tat ein Blatt, das die „Bedingungen der Möglichkeiten des Handelns“ auszuloten versucht. Hier tummelt sich der Unmut über die herrschenden Verhältnisse und auch eine gewisse Zeitmenge an falscher Praxis – in meinem eigenen Falle dann doch Jahrzehnte linken Possenspiels. Die nachholende allergische Reaktion auf die in den diversen Verfallsprodukten der Linken vergeudete Lebenszeit ist dem Blättchen auch eingeschrieben. Ein zugegeben überschäumender Aktivismus ist mit den Skurillitäten und der eklektischen Theoriemixtur der Treibstoff des Hefts. Die wütende Attacke auf ein prozessierendes Abstraktum muß selbstverfreilich recht albern ausschauen. Das heißt aber nicht, daß eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was als Voraussetzung der Möglichkeit überhaupt zu erst zu denken, also mit dem tendenziellen Verfall selbst dessen, was einmal notwendig falsches Bewußtsein war, bitter nötig wäre. Bloßes revolutionäres Wüten führt zu Handeln, das nicht lediglich „integriert“ wird, sondern zu weit schlimmerem – die Toten in Griechenland sollten als Verdeutlichung in welche Richtung das geht doch wohl genügen.
„Bedingungen der Möglichkeiten des „Handelns““
hä?
Hm, eigentlich hatte ich gehofft, jemand würde mir mal das ausreden, was ich NICHT über „egal“ geschrieben habe. Der ist mir nämlich genauso „egal“ wie seine Zeitung, in die ich nach Lektüre des Artikels nur einen flüchtigen Blick geworfen habe und darin weder schlimmes noch interessantes entdecken konnte. Widerlich an seinem Kommentar – und dabei bleibe ich – fand ich die Denunziation einer „erbärmlichen Sinnkrise“. Spätestens damit war begründet, dass sich Böhm nicht ernsthaft mit solchen Leuten auseinandersetzt, mögen sie sich nun antideutsch nennen oder nicht.
Anderes scheint mir aber für die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeiten des „Handelns“ zu gelten, die ich oben versucht habe aufzuwerfen. Denn: Wenn ich damit recht hätte – und ich hoffe, dass dies nicht zutrifft – dann hätte das gewiss weitreichendere Konsequenzen, als die „strassen aus zucker“.
Äh, ich habe in den letzten Jahren wohl nicht mehr alles mitgekriegt. Was um alles in der Welt sind diese Straßen aus Zucker??? Ne bundesweite Ausgabe des Zuckerkick??????
Äh, nur so. Ja.
Und noch eins: Antideutsch ist eine Zuschreibung Dritter, das wird man auch ganz ohne eigenes Zutun – mir macht’s aber seit geraumer Zeit viiiiiel Spaß….
so bemitleidenswert bist du dann auch nicht wie du es möchtest, aber du scheinst ja doch diesen blog und vor allem die unterhaltung stets zu verfolgen. lob! lob!
glück brauchen wir wohl nicht und den erfolg werden wir uns alleine einstreichen müssen. so überheblich darf man sein.
du hast es ein wenig falsch getroffen mit „feindaufklärung“…
aber wie ich sehe gibt es ja mittlerweile eine 3. auflage. schrecklich.
ja, ich will nur die straßen aus zucker weiter verbreiten und deshalb poste ich hier auf diesem großen blog und schreibe immer wieder „straßen aus zucker“.
und ja, es total ok, das euer autor sachen behauptet, die nicht stimmen, weil er schlicht nicht die zeit hat sich die kritisierten sachen auch durchzulesen, denn ja, alles außer eurem blatt wird von 2-3 ums ganze-theoretikern geschrieben, v.a. aber jeder einzelen text in der straßen aus zucker. die straßen aus zucker ist nämlich ein 100%iges ums ganze-projekt. eigentlich sollte das geheim bleiben, aber ihr habts nun enttarnt. vielleicht solltet ihr einfach zum vs gehen, mit euren überragenden fähigkeiten in der feindaufklärung. und die straßen aus zucker wird nun wohl nicht mehr erscheinen, wo das alles raus ist. schade. aber euch noch viel glück und erfolg!
hahahaha
„was ist denn die kritik an der „straßen aus zucker“?“
kann man so etwas denn kritisieren?
Entschuldigung Egal,
jedoch scheint dein Anliegen lediglich einer weiteren Verbreitung der „Straßen aus Zucker“ Zeitung zu sein. Deine vorwurfsvollen Aussagen o-ton „erbärmliche sinnkrise“, scheint weit da hergeholt oder möchtest du es ein wenig präzisieren?
Ob ihr nun 500.000 exemplare an scheiße produziert hättet, wäre mir auch egal, wenn wenigstens der inhalt mehr als nur dummes geplänkel zwischen den „fronten“ (obwohl ihr nicht einmal eine ernstzunehmende truppe oder gar opposition seid) wäre. es ist tatsächlich wahr, wenn du sagst, „die „straßen aus zucker“ ist nicht antideutsch“. Verzeihe dem Autor, dass er nicht jedes beschämende flugblatt und jeden anderen langweiligen demoaufruf für irgendeine verschissene demo gelesen hat, die aus der ein und selben feder von den 3 ums ganze „theoretikern“ kommen. aber mal ganz ehrlich, dass kann sich ja auch niemand wirklich antun. selbst eure leute hinter dem fronttransparent wissen doch erst auf den fotos, die er auf indymedia einsehen bescheid, weswegen sie demonstrierten. oder für und gegen was.
genau deswegen schaffst du es doch auch nur am ende deines statements (mehr ist es einfach nicht), dass kampagnenmotto hinzuklatschen.
bleib auf dem teppich – vielleicht schaffst du die wunderlampe zu streicheln, damit auch euch mal ein wunsch in erfüllung geht, nämlich die straßen aus zucker. man hoffe es wird wie 1997 in sachsen regnen!
erbärmlich wird seine verschriftliche sinnkrise dadurch, dass er argumentationslos sachen disst und in schubladen packt, wo sie nicht reingehören. was ist denn die kritik an der „straßen aus zucker“? das wird in den ebenso peinlichen benjamin-solidaritäts-kommentaren auch nicht begründet. selbstvergewisserung durch gebashe „der anderen“… ganz großes kino!
„Wenn sie nur noch dissen können, ist das keine Revolution.“
Ihr seid auf so putzige Art so 2004. Bitte weitermachen, vor allem hä? ist sehr fein!
Warum reagieren manche Kommentatoren eigentlich so aggressiv? „Benjamin Böhms erbärmliche Sinnkrise“? Fällt dem Schreiberling dieser paar Wörter eigentlich nichts auf? Wenn es so wäre, dass er eine Sinnkrise hätte, wäre es ihm vorzuwerfen? Das Wörtchen „erbärmlich“ verrät in jedem Falle viel über den Schreiberling – ebenso das Pseudonym „egal“ -, nichts aber über Böhms Text.
Und: Was lässt sich sinnvolleres mit einer Sinnkrise anstellen, als sie produktiv (!) zu nutzen, d.h. vielleicht auch einen Text zu verfassen.
Nun scheint es mir eher unwahrscheinlich, dass die Egotronic-Fans bei Böhm eine Sinnkrise ausgelöst haben; aus seinem Text spricht eher die Ohnmacht:
Jene Ohnmacht, die jedem bekannt ist, der das „Begehren (..), das eigene geknechtete, unwürdige Leben hinter sich zu lassen“ teilt; ein Begehren, dass sich niemandem demonstrieren lässt, der sich mit diesen Verhältnissen arrangiert hat.
Dafür sind die Egotronic-Fans ebenso symptomatisch, wie „egal“: Ihrer eigenen Ohnmacht entkommen sie, indem sie sich ihres Bewusstseins entledigen und zu kriegsähnlichen Geräuschen zucken (Tanzen ist etwas anderes); und/oder auf die Ohnmächtigen einschlagen, indem sie sie einer „erbärmlichen Sinnkrise“ denunzieren.
Auch der Vorwurf des „Kulturpessimismus“ (Oma Erna) ist ziemlich langweilig. Mir ist der Text nicht („kultur“)pessimistisch genug!
Wenn Erna schreibt, „kontemplativer defätismus und lebensphilosophischer aktionismus sind nur die beiden seiten der medaille der sich dumm machen lassenden ohnmacht“ so kann ich ihm darin nur zustimmen. Augenfällig nehmen sich ein autonomes Zentrum und eine Elektro-Party (auch ersetzbar durch jede andere Disko-party) an Ödnis und Langweile nicht viel.
Ich erkenne aber keinen grundlegenden Widerspruch zu Böhms Text. Den „Aktionismus“ hatte er schließlich mit den Worten kommentiert: „Es geht mir hier nicht um die Glorifizierung von Bankenanzünden oder Freiraumkampagnen, sondern um die Einforderung der Revolution im Jetzt und Hier.“
Mit dieser Einforderung, hätten sie sie ernst gemeint (!), hätten die Autonomen recht gehabt gegenüber allen linken Theoretikern. Wie ernst es ihnen aber damit tatsächlich war, kann man an ihren Biographien studieren.
Nun aber dazu, was ich damit meine, dass mir Böhms Text nicht „pessimistisch“ genug war:
So richtig die Einforderung der Revolte im „Hier und Jetzt“ ist, so wenig lässt sich von ihren Bedingungen abstrahieren und ein abstraktes „Handeln“ einfordern. Soll die Revolte mehr sein, als ein bloßes Banken anzünden, (wo dann, wie jüngst geschehen, auch mal nicht nur eine Bank, sondern auch Menschen „platt gemacht“ werden), sie setzte halt doch mündige Individuen voraus.
Und damit ergibt sich jedenfalls mir ein ganz anderes Dilemma: Aushalten zu müssen, was nicht auszuhalten ist.
Böckelmann hat einmal irgendwo über Aggressionen, in denen sich auch das Aufbegehren gegen diese uns auferlegten Verhältnisse ausdrücken kann, geschrieben, sie wären einzig realitätsgerecht, richteten sie sich gegen das ganze abstrakter Herrschaft. Die kann man aber bekanntlich nicht einfach anzünden.
Eine „Aktion“ kann darum entweder „nur“ ein Akt bloßer Selbstverteidigung sein (wogegen nichts einzuwenden ist); oder aber symbolisch – dann aber kann man eben nicht von den Bedingungen abstrahieren, dass sie überhaupt verstanden werden kann.
So ist der Satz, „wenn für eineN so genannteN KritikerIn jedes Handeln zum Scheitern verurteilt ist, dann hat sie/er bereits die politikwissenschaftliche Verkürzung akzeptiert, dass jegliches Handeln Politik sei“ derjenige, mit dem ich die größten Probleme habe.
So wenig jedes Handeln a priori zum Scheitern verurteilt ist, so wenig lässt sich davon absehen, dass Gesellschaft und Ideologie bislang (!) noch jede „Handlung“ i.d.S. integrieren konnten.
Einzig Reflektion könnte das verhindern; und nur unter der Voraussetzung mündiger Rezipienten wäre eine „Aktion“ ein Akt der Erkenntnis ermöglichte.
Man kann sich dies meinetwegen an der Kunst verdeutlichen: Gerade wo sie nicht unmittelbar „politisch“ ist, läge in ihr die Möglichkeit zur Erfahrung; diese Möglichkeit ist aber nicht überzeitlich; soll beim Rezipienten etwas anderes herauskommen, als er vorher hineingelegt hat (z.B.weil ihm das der Audio-Guide im Museum gesagt hat), so setzt das die Bereitschaft voraus, mehr sehen (oder hören), erkennen und denken zu wollen, als ihm befohlen wird.
Diese Bereitschaft zu provozieren wäre die Aufgabe von Kritik; darum ist sie nicht „kontemplativ“ und auch nicht abstrakt der „Handlung“ entgegenzusetzen; darum muss sie aber auch das Scheitern des Handelns reflektieren, ohne sich davon unbekümmert sein zu lassen.
alle artikel zusammen, die benjamin böhm schreiben könnte, wären noch lange nicht so konterrevolutionär, wie ein einziges exemplar des scheißhauspapiers strassen aus zucker. das liegt daran, dass benjamin böhm spürt, dass etwas mit der linken nicht in ordnung ist, er es aber nicht versteht und erst recht nicht aussprechen kann. dagegen sind die rattenfänger und nachwuchspolitniks der umsganze bagage und konsorten einfach nur ordinärer abschaum.
„berliner dominaz in allen lagen?“
hahahahaha. was es für vollpfosten gibt im netz, es ist wirklich fantastisch.
berlin ist ein genauso langweiliges kaff wie hirbel am rangen. hat mal jemand gesagt, der beides kannte.
wer das anders sieht, mag. hat mir aber nichts mitzuteilen.
egotronic ist schon eine lustige sache. schlechter elektro mit peinlichen texten, aber wie ein fliegenfänger für leute, die sich ansonsten alle zwei jahre schwarzrotgold ins gesicht malen.
strassen aus zucker ist irgendwie auch langweilig. was? 100.000 stück? schade um das papier, damit hätte man ca 3.000 jahre lang feuer anmachen können.
aber die kommentare zu dem artikel sind gut geworden. das macht beni so schnell keiner nach, sie lesen sich fast echt.
gemerkt habe ich es erst bei dem satz
„und dann erbringt man als David die Nachweise, dass Egotronic nämlich in echt eine Patriotenband ist“
als david! das war natürlich eine feine anspielung darauf, dass er, wie alle wissen, die ihn kennen, sehr oft einen gewissen dämlichen witz betreffs seines vornamens hat hören müssen (benjamin=der jüngste der brüder). in echt schreibt aber natürlich niemand mehr in solchen biblischen metafern.
Aber ist das nicht einfach eine sehr persönliche Notwendigkeit, also aus dem eigenen provinziellen Mief auszubrechen und provokant die Berliner Dominanz in allen Lagen anzugreifen, als Selbstvertrauen spendende Maßnahme die Sinnkrise des dritten Semesters zu Überwinden, in dem man den Beweis antritt gelesen zu haben und dann erbringt man als David die Nachweise, dass Egotronic nämlich in echt eine Patriotenband ist? Vielleicht kommt die Beschäftigung mit Signifikanz und Logiken der Kulturindustrie auch einfach erst im nächsten Jahr dran. Es bleibt spannend!
die „straßen aus zucker“ ist nicht antideutsch und kann auch nichts für benjamin böhms erbärmliche sinnkrise. die über 100.000 exemplare, die in den letzten 14 monaten bundesweit verteilt wurden haben mit ihrer kritik an staat, nation und kapital sicher 100.000 mal mehr für „die revolution“ gebracht, als alles was er jemals zustande gebracht hast und noch zustande bringen wird.
you got to let the music – wir wollen die freiheit der welt und straßen aus zucker!
ein sehr schwacher text. was anderes als ein pseudoradikaler lifestyle, der nur die spiegelseite zum pseudohedonistischen konformismus darstellt, ist die einforderung einer „Fuck-Off-Mentalität“, die „dem Bestehenden produktiv [sic!] zu schaden gedenkt“? kontemplativer defätismus und lebensphilosophischer aktionismus sind nur die beiden seiten der medaille der sich dumm machen lassenden ohnmacht. negativität liegt immer in der kritik, die sich ihre radikalität und eben auch geduld (die keineswegs mit passivität gleichzuschalten ist) nicht abmarkten lässt.
das gelaber über die antideutschen*, die ob ihrer vermeintlichen popkulturellen infiltrierung nicht mehr die kritiker von „früher“ seien, ist nichts als bornierter kulturpessimismus. da ist auch das dezidierte lob der autonomen (die immerhin noch den anspruch an den tag legten gesellschaftskritik nicht als hobby, sondern naiv als lebensweise zu betreiben) nur lüge. überhaupt ist die neue linke seit 68ff, deren ausläufer noch heute dahin siechen, letztlich nichts als ein gegenkulturelles und -politisches alternativmodell. kommunistische kritiker_innen haben sich immer nur als individuen (zu mehr langt es leider nicht) von jener abgesetzt. auf dieses dilemma und seine konsequenzen ist zu reflektieren und nicht über die angebliche dekadentisierung herumzuheulen. das ist nämlich selbst nur linkes herumgefurze.
*eine kritik „der“ antideutschen hätte sich zumindest an ihren avanciertesten vertretern abzuarbeiten. zu thematisieren wäre, wie eine kommunistische kritik, die zu recht den geschichstbruch auschwitz ins zentrum der reflexion setzt, zum liberal-marxismus verkommen ist.
die hate-redaktion gibt dem autor in allen belangen recht und nennt das magazin mit sofortiger wirkung the last hate und widmet sich essentiellen dingen des lebens. nächste woche gehts nach paris, revo machen!
der hate-graphiker dementiert jemals eine uni von innen gesehen zu haben (außer die mensa)