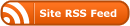(auf seinen Beitrag aus hype#15)
Die Höflichkeiten, die mein sehr geschätzter Gegner mir zuteil werden lässt, nehme ich dankend entgegen; in meiner Entgegnung will ich mich auf zwei Dinge konzentrieren, die mir unter vielem nutzlosen in der Debatte untergegangen zu sein scheinen. Vielleicht genügt es ja dazu , ihn nochmals zu einer Erwiderung zu provozieren; und vielleicht gewänne die Debatte dadurch eine gewisse Tiefe, die ihr bisher fehlt.
1. Adorniten, gar Antideutsche: ich habe es nach ausführlichem Studium der Sache dahin gebracht, nicht mehr zu wissen, was das sein soll. Ich kann nur schwer auf Sätze antworten, in denen über diese beiden Personengruppen Vermutungen angestellt oder Urteile ausgesprochen werden. Ich bekäme sonst das Gefühl, ich redete über Gespenster.
„Gewisse Antideutsche“ haben diese oder jene Ansichten über den Nationalsozialismus, das kann sogar sein, aber was interessiert es mich? Ist damit garantiert, dass es sich um auch nur diskussionswürdige Ansichten handelt? Wohl kaum. Das ISF aber „z.B.“ habe erklärt, der Nationalsozialismus sei eine eigenständige Gesellschaftsformation; aber genügt die Ungeheurlichkeit dieses Gedankens, ohne Ansehen eventueller Gründe, um ihn schon zu widerlegen? Wohl kaum.
„Ausblenden lässt sich die Katastrofe nicht“, erklärt Ndejra apodiktisch; aber was soll ich von solchen Sätzen halten, wenn ich doch in einer Wirklichkeit lebe, in der die Katastrofe sehr wohl ausgeblendet ist?
Vor allem in der Linken, wie man weiss, und auch in ihren vernünftigsten Teilen. Man lese doch nur mal in ihren Diskussionsforen nach, und sei es libcom.org oder ähnliches! Man bekommt dort vielleicht einen Begriff davon, was unter „Verblendung“ verstanden werden könnte.
Ndejras Kritik ist nach der einen Seite eine Kritik einer mehr oder minder wahllosen Menge von Einzelansichten. Das ist mässig sinnvoll, soweit sie nicht die Kritik des Ganzen ist, wie es sich meinetwegen in den Köpfen einer bestimmten Schule widerspiegelt.
2. Ndejra zielt auf der anderen Seite deshalb auch auf eine grundsätzliche Kritik der Frankfurter Schule; er will ihr eine Art von Komplizenschaft nachweisen mit dem Denken der Gesellschaft, die sie vorgeblich bekämpfe, und zwar in der Weise, dass sie ausgesprochen oder nicht von denselben Grundannahmen wie dieses ausgehe. Er nennt ausdrücklich das Grundverständnis über die Herrschaft über die Natur und die Herrschaft des Menschen über den Menschen.
Der Vorwurf erstaunt mich immer noch; weil er erstens nicht weiter ausgeführt wird (es müssten sich doch Spuren in Adornos oder Horkheimers Schriften anführen lassen), und zweitens, weil er sich mit dem Gegeneinwand nicht auseinandersetzt, der sich doch aufdrängt: dass gerade diese beiden die Begriffe geschaffen und in Anschlag gebracht haben, die Ndejra jetzt gegen die kritische Theorie einsetzen will.
Nichts gegen die radikale Kritik von allem und jedem! Die Kritik darf vor nichts haltmachen, sie muss sich zuletzt auch gegen ihre eigenen Voraussetzungen wenden; aber mir scheint Ndejras Kritik, gesetzt, sie hätte Substanz, eigenartig ihre eigene Herkunft zu verleugnen.
Hat nicht die kritische Theorie als erste die Naturbeherrschung überhaupt als ein Problem gefasst? Hat sie nicht als erste klar ausgesprochen, dass sich im Drang zur Beherrschung der Natur die Herrschaft des Menschen über den Menschen immer reproduziert, so dass beides als zwei Seiten desselben Verhältnisses verstanden werden muss?
Nimmt Ndejra Anstoss an den Formulierungen, in denen Horkheimer und Adorno die fehlgeschlagene Emanzipation des Individuums zum Subjekt in der Dialektik der Aufklärung beschreiben? Enthalten diese ambivalenten Formulierung seiner Ansicht nach etwa eine Bejahung der Naturbeherrschung, oder machen sie sie nicht gerade zuerst als Problem fassbar, das unlösbar in die Strukturen dieser Gesellschaft eingelassen ist, und nur mit diesen aus der Welt zu schaffen?
Ich habe es immer so verstanden.
3. Ndejra stützt sein kategorisches Urteil über die kritische Theorie auch auf die einfache Ausflucht, die sie beflissenen Studenten zu bieten scheint; er macht aber damit auch die Tür auf zu einer anderen einfachen Ausflucht, und scheint es nicht zu sehen.
Wenn man die kritische Theorie beiseiteschiebt, dann gibt es keinen Grund mehr, sich Rechenschaft abzulegen über die historischen Bedingungen der Vernunft, das heisst der Möglichkeit, überhaupt zu denken; und über den ebenso historischen Prozess der Zerstörung genau dieser Bedingungen. Es ist dann desto leichter, sich um das zu betrügen, was Rosa Luxenburg seit 1914 gefordert hat, nämlich die grausam gründliche Selbstkritik des Proletariats.
In mehr als einer Weise ist die kritische Theorie die Form, und zwar nahezu die einzige Form, in der diese Selbstkritik Wirklichkeit geworden ist. Sie ist nichts, an dem man leichthin vorbeigeht. Ihre Aporien sind noch die unseren. Ihr Programm ist noch lange nicht abgearbeitet, es wird uneingelöst bleiben, solange diese Weltordnung Bestand hat.
Arbeite man also weiter daran! Aber auf einer vernünftigen Grundlage.
4. Hat nicht die Negative Dialektik noch einiges zu bieten, was Ndejra brauchen könnte? Gibt es eine tiefer gehende Ausführung des logischen Problems des Verhältnisses von Allgemeinem und Besonderem, von konkretem Einzelding und abstraktem Begriff? Ist nicht für die anti-politische Tendenz, die Ndejra und ich ja, nehme ich an, teilen, diese Frage von allergrösstem Interesse?
Wenn Adorno die Identität, die den Dingen unter der Herrschalt des Begriffes aufgezwungen wird, als Identität des (Identischen mit dem) Nichtidentischen sichtbar macht: ist das für einen Begriff der Herrschaft oder der Befreiung etwa gleichgültig? Hat irgendein Logiker jemals vorher einen Begriff vom Nichtidentischen auszuführen versucht, vom dem also, was in seinem Begriff gerade nicht aufgeht?(1) Dem also, wovon nie gesprochen worden ist, dem, was in jeder Sprache immer nur verraten und beschwiegen worden ist, dem zertretenen und zerschlagenen, genau dem, was zu befreien wäre?
Können wir uns nicht, allgemein gesprochen, alle Versuche, eine Sprache oder irgendein Mittel des Ausdrucks zu erobern, in die Fuge streichen, wenn wir zu genau diesem logischen Versuch nicht in der einen oder anderen Weise einen Zugang finden?
Die Negative Dialektik ist nicht die grosse Methode. Aber weil ihre Probleme noch die unseren sind, weil seither so vieles nicht passiert ist, enthält sie schon, im wesentlichen, alle Fragen, die sich uns aufdrängen, die wir aber nur mit Mühe wieder aus ihr herauszuarbeiten haben.
Was also ist denn „die wirkliche Bewegung, die den gegenwärtigen Zustand aufhebt“, von der Ndejra redet? Wo sieht er sie? Besteht sie (wenn sie denn überhaupt besteht) unabhängig von der Selbstkritik des Proletariats, die Rosa Luxenburg gefordert hat? Ist sie nicht zwingend zurückverwiesen an eine „Filosofie, die einmal erledigt schien“, aber sich am Leben erhält, „weil der Zeitpunkt ihrer Verwirklichung versäumt ward“? Mehr noch, fällt sie nicht mit dieser in eins? Wenn nicht, um so schlimmer!
(1) Warum bloss hat man nie eine Kritik an der kritischen Theorie gehört, die sich explizit darauf gestützt hätte, die Negative Dialektik immanent, d.h. entlang ihres eigenen (kommunistischen) Anspruchs zu kritisieren?